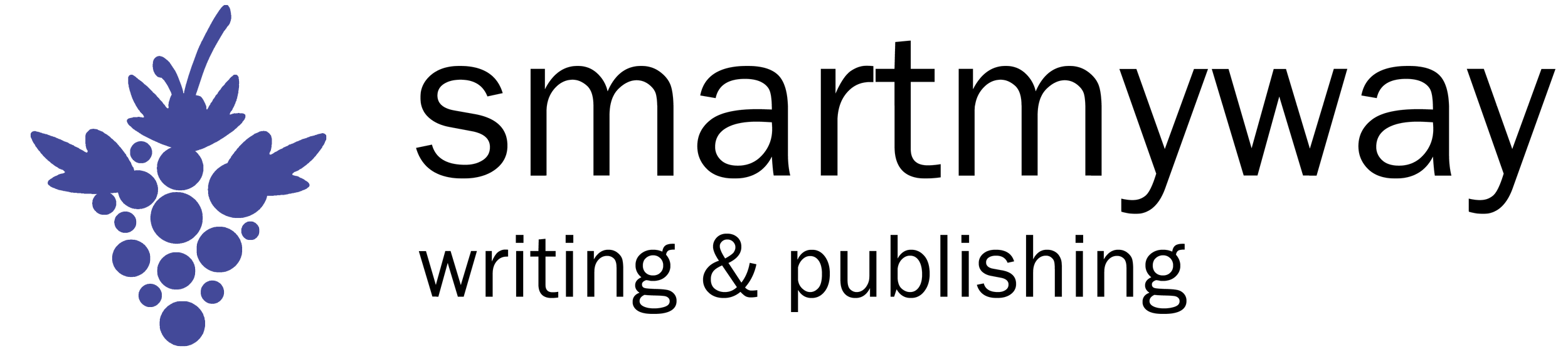Wenn die Grossen mit den Kleinen.

Mit dem Strompreis bezahlten die Konsumenten im Sottoceneri 2024 dem Staat über 60% Steuern und Abgaben, die nicht direkt die nutzbare Stromenergie betreffen. Gleichzeitig erhielt ich als kleiner Photovoltaikstrom-Produzent von der AET nur 3 Rappen pro eingespeister Kilowattstunde. Im Aargau etwas mehr, doch 2025 ist auch dort die gleiche signifikant rückläufige Tendenz zu beobachten. Was passiert da?
Wir bezahlen also 60% für die Verpackung und 40% für das Produkt. Für die Einspeisung erhalten wir von der AET mit 3.2 Rappen nahezu nichts pro selbstproduzierter Kilowattstunde Photovoltaikstrom. So sieht die Realität im Sottoceneri im Kanton Tessin mit den Stromkonditionen aus. Ist dies gerechtfertigt? Wohl zum Teil - Infrastrukturen müssen unterhalten werden, der Markt spielt. Doch gerade in Zeiten, in denen die Energie knapp wird, sollten nicht nur Einwohnerinnen und Einwohner den Gürtel enger schnallen müssen, sondern auch Behörden und besonders Betriebe, die in staatlichem Besitz sind, wie es die Stromunternehmen in der Regel sind. Doch es macht den Anschein, dass die mit der Energiekrise der letzten Jahre verbundenen Risiken durch die staatlichen Monopolisten grösstenteils den Konsumentinnen und Konsumenten übergewälzt und daraus wohl auch Profite erzielt wurden. Gleichzeitig haben die Endabnehmer keine Anbieterwahlmöglichkeit eines freien Marktes. Die Axpo als grosse Playerin im Strommarkt verzeichnet im Gegenzug in dieser Periode ihr zweitbestes Geschäftsjahr und zahlt unverfroren Boni aus. Energie ist vital für die Gesellschaft, die aktuelle Energiepolitik beginnt die Gesellschaft zu spalten und gefährdet langfristig den sozialen Frieden. Dies macht Sorgen. Und es ist möglicherweise das grösste Problem, dem die Schweiz entgegensteuert.
Roland Voser, 31. Januar 2025
Inhalt.
2. Das kann doch nicht wahr sein!
3. Die Protagonisten dieser Geschichte.
4. Beim Strom ist die Verpackung teurer als das Produkt.
5. Die Antwort der AET überzeugt nicht.
6. Der Strommarkt ist für Besitzer von kleinen Photovoltaik-Anlagen von Nachteil.
7. Was wäre eine faire Rückvergütung?
8. Gelingt so die Energiewende?
9. Enttäuschung auch im Aargau.
10. Ist die AIL eine gute Alternative zur AET?
11. Das Lebenselexier Energie.
12. WAS, WIE und WARUM entscheiden.
13. Energiepolitik ist seit Jahren nicht zielführend.
14. Gesellschaft ist gespalten.
1. Prolog.
Als Deutschschweizer und zufriedener Aargauer über das Tessin zu schreiben und Kritik zu üben, das geht ja eigentlich nicht. Auch wenn man seit 50 Jahren immer wieder in diesem wunderschönen Südkanton weilt, man bleibt Gast und Deutschschweizer, und damit hat man zu akzeptieren, wie es ist. Das ist richtig so.
Man ist diese lange Zeit dort, weil es ein guter Ort ist. Hat Freundschaften geschlossen, das Leben des Kantons kennengelernt und daran teilgenommen. Bald auch das reiche kulturelle Angebot auf kleinem Raum schätzen gelernt. Hat Erfahrungen mit Behörden und Firmen gesammelt, und grossmehrheitlich waren sie gut, ja ausgezeichnet. Das gilt auch für die AIL und die AET, die im folgenden Erfahrungsbericht in den Fokus rücken. Freundlichkeit und Professionalität sind durchaus Attribute die hier angebracht sind. Würde Italien mit dieser Ernsthaftigkeit und Sorgfalt geführt, wie es das Tessin tut, dann wäre das bel paese zweifellos an der Weltspitze.
Die vorliegende Einmischung aus dem Norden ist durchaus konstruktiv gemeint. Aber eigentlich zielt diese Geschichte auf eine andere Ebene: Es geht um die missratene Energiepolitik der Schweiz der letzten Jahre - diesmal beleuchtet aus dem Blickwinkel eines Betroffenen, der die Reste nationaler Wirkung im Tessin und im Aargau erlebt.
Also, Vorhang auf!
2. Das kann doch nicht wahr sein!
Habe ich recht gelesen? Die AET vergütet mir hier im Sottoceneri im Kanton Tessin während der Sommermonate pro eingespeister Kilowattstunde aus meiner Photovoltaik-Anlage lächerliche 3.2 Rappen (Nullkommanulldreizwei Franken!)? Das muss ein Missverständnis sein, denn gleichzeitig bezahle ich der AIL SA im Schnitt rund 33 Rappen für eine Kilowattstunde in der gleichen Gemeinde. Diese Kosten beinhalten gemäss der Rechnung für das Jahr 2024:
ca. 25.5% Netznutzung
ca. 41.5% Kosten für den Strom
ca. 33.1% Steuern und Abgaben (inkl. 8.1%-Mehrwertsteuer, ihr Anteil entspricht in dieser Rechnung 12.3%)
Enttäuschung macht sich bei mir breit. Und Ratlosigkeit wegen all dieser komplizierten Zusammenhänge und Strukturen im Stromwesen. Kann das wirklich sein? Eine Kilowattstunde sauberer Photovoltaikstrom soll nur 3.2 Rappen Wert sein? Im Folgenden ein Aufklärungsversuchs.
3. Die Protagonisten dieser Geschichte.
Die AIL SA ist vollständig im Besitz der Gemeinde Lugano und ist demnach de facto ein Staatsbetrieb, der im Rahmen privatwirtschaftlicher Strukturen arbeitet. Sie stellt die Strom- und Wasserversorgung im Sottoceneri für 117’000 Kunden sicher. Sie ist für sie auch eine mögliche Abnehmerin deren Photovoltaik-Stroms. Die AIL kommuniziert für das Jahr 2023 einen Umsatz von 535 Millionen Franken mit einem Betriebsgewinn von 52 Million Franken (vor Abschreibung und Wertberichtigungen, entspricht wohl in etwa dem EBITDA). Vereinfacht gesagt, weist das Unternehmen somit eine Umsatzrendite von knapp 10% aus. Diese 10% fliessen in die Gemeindekasse der Stadt Lugano - was somit aus Sicht der Stromkonsumenten einer indirekten Steuer entspricht.
Die AET ist vollständig im Besitz des Kantons Tessin und eine öffentlich-rechtliche Anstalt. Sie produziert und kauft Energie ein und beliefert Grosskunden wie die AIL im Tessin. Sie ist im Zusammenhang mit der kantonalen Förderung erneuerbarer Energien ebenfalls eine Abnehmerin für den Strom aus Photovoltaik-Anlagen. Sie hat im Jahre 2023 rund 1 Milliarde Umsatz erzielt. Ihre Gewinne gehen vollumfänglich an den Kanton Tessin (also für ihre Kunden auch eine indirekte Steuer).
Die AEW Energie AG ist vollständig im Besitz des Kantons Aargau. Sie ist ein selbstständiges Unternehmen und sorgt für eine sichere und nachhaltige Energieversorgung in der Region. Sie ist Abnehmerin für den Photovoltaik-Strom. Sie hat im Jahre 2023 ein Unternehmensergebnis von 88.8 Million CHF erzielt, das dem Kanton zu Gute kommt (also auch hier eine indirekte Steuer).
Roland Voser ist Elektroingenieur und hat eine Photovoltaik-Anlage im Aargau und deren zwei im Tessin realisiert. Er hat sich mit dem Thema mehrfach auseinandergesetzt und ist begeisterter Elektroautofahrer (Fiat 500e, Polestar 2). Er ist seit über 40 Jahren Steuerzahler.
4. Beim Strom ist die Verpackung teurer als das Produkt.
Die Strompreise der AIL querfinanzieren also die Gemeindekasse von Lugano. Das ist ein spannender Blickwinkel: Über die Strompreise bezahlen die Einwohnerinnen und Einwohner der umliegenden Gemeinden also eine indirekte Steuer an die Gemeinde Lugano. So habe ich das bisher noch nie betrachtet: Eine Gemeinde zieht defacto Gemeindesteuern bei Einwohnern anderer Gemeinden ein. Somit wäre die obige Aufstellung entsprechend zu korrigieren, nämlich, indem die 10% Umsatzrendite bei den Kosten für den Strom abgezogen und im korrekten Verhältnis den Steuern und Abgaben wieder hinzu gerechnet werden. Daraus ergeben sich für 1 Kilowattstunde neu folgende Anteile:
ca. 25.4% Netznutzung
ca. 37.3% Kosten für den Strom
ca. 37.3% Steuern und Abgaben (inkl. Mehrwertsteuer-Anteil)
Bei der Netznutzung werden Anschlussgebühren verrechnet. Sie betragen in diesem Beispiel bei einem 25 Ampère-Anschluss 3.80 CHF pro Ampère pro 90 Tage. Dies entspricht 380.- Franken im Jahr. Damit ist die Liegenschaft ans Netz angeschlossen und kann Stromenergie beziehen, nutzen und zurückliefern. Die Grösse ist durch den Verbrauch oder die Einspeisung bestimmt: Grosse Verbraucher wie Elektrofahrzeuge benötigen beispielsweise einen stärkeren Anschluss. Mit 25 Ampère funktioniert das inklusive Photovoltaik-Anlage gut. Die Politik der fixen Anschlusspreise benachteiligt anderseits kleine Verbraucher. Diese in absoluten Zahlen kleinen Beträge können in der übergeordneten Betrachtung wohl vernachlässigt werden, sind aber für Kleinverbraucher kundenunfreundlich und fördern so gesehen das Energiesparen nicht. In meiner Anlage ist der Betrag für den Netzanschluss in der gleichen Grössenordnung, wie der Stromverbrauch an sich - was ein Missverhältnis ist. Das Ganze, obwohl Energiesparen massgeblicher Teil der Energiestrategie war.
Der tatsächlich nutzbare Energieanteil beim Strompreis liegt also unter 40%. Mehr als 60% sind Kosten, die in der Liegenschaft des Kunden keine direkte Wirkung erzielen, sondern irgendetwas der Allgemeinheit oder des Stromlieferanten finanzieren. Dieses Missverhältnis ist nicht nachvollziehbar und schafft beim Anbieter falsche Anreize. Man würde erwarten, dass der Strompreis beispielsweise aus 75% für den tatsächlich nutzbaren Strom und möglicherweise 25% für alles andere bestehen würde. Das wirft Fragen auf, denn wer würde mehr für die Verpackung als das Produkt bezahlen?
5. Die Antwort der AET überzeugt nicht.
Die eigentlichen Stromkosten machen also 13.2 Rappen pro Kilowattstunde aus. Doch wieso bezahlt die AET ihren Kunden im Gegenzug dennoch nur 3.2 Rappen für den selbstproduzierten Strom aus Photovoltaik-Anlagen (für Wasserkraft 5.237 Rappen) ? Also nur einen Viertel des Preises, den die Konsumenten in der gleichen Stunde zu bezahlen haben? Oder gar nur 10%, wenn die effektiv verrechneten Kosten pro Kilowattstunde herangezogen werden?
Das Unternehmen meint dazu Folgendes (siehe auch hier):
“Vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Wir verstehen Ihr Bedauern, doch auch mit den neuen Tarifen bietet die Installation einer Photovoltaikanlage weiterhin wichtige Vorteile, und eine sorgfältige Optimierung des Eigenverbrauchs kann zu erheblichen Einsparungen auf Ihrer Rechnung führen. Die Einspeisevergütung spiegelt den Marktwert der photovoltaischen Energie während des Produktionsquartals wider. Im zweiten und dritten Quartal ist die Produktion trotz geringerer Nachfrage und eines niedrigeren Energiewerts deutlich gestiegen.
Da es nicht möglich ist, die entnommene Photovoltaik-Energie zu speichern oder an Endkunden weiterzuverkaufen, bewertet AET sie auf dem Markt, wenn sie ins Netz eingespeist wird. Der von AET angebotene Preis spiegelt also den tatsächlichen Marktwert der von den Photovoltaikanlagen im Quartal der Entnahme erzeugten Energie wider. Die Verteilerunternehmen hingegen kaufen die Energie, die sie an ihre Endkunden weiterverkaufen, bereits mehrere Jahre vor der Lieferung. Ihr Tarif spiegelt daher den durchschnittlichen Marktwert der letzten 2-3 Jahre vor dem Jahr der Lieferung wider.
Falls Sie Fragen zu diesem Thema haben, möchten wir Sie auf folgende Publikation auf unserer Website verweisen: FAQ. Wir sind überzeugt, dass sich Ihre Investition dank der erhaltenen Anreize und der Maximierung des Eigenverbrauchs gelohnt hat und weiterhin rentieren wird. Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen”
Langsam dämmert es: Der vom Kanton Tessin zur Verfügung gestellte Fonds für Erneuerbaren Energien (Fondo energie rinnovabili FER) ist nicht tatsächlich eine Förderung, sondern vielmehr ein Vorschuss. Für die Anlage mit einer installierten Leistung von 4.92 kWp hat der Fonds CHF 1’084.- ausbezahlt. Im Gegenzug werden für die Kilowattstunde nur noch marginale Beiträge vergütet. Im zweiten Trimester 2024 waren es die besagten 3.2 Rappen pro Kilowattstunde. Der Rest zum tatsächlich erzielbaren Erlös kann also mit dem gedanklichen Vorschuss verrechnet werden: Wenn dieser Uplift beispielsweise 10 Rappen beträgt, wäre nach 10’840 Kilowattstunden der Vorschuss zurückbezahlt. 2023 und 2024 hat unsere Anlage im Tessin rund 3’000 Kilowattstunden zurückgeliefert. Nach ca. 7 Jahren wäre also der Vorschuss zurückbezahlt und jede weitere Kilowattstunde ginge zu einem viel zu tiefen Tarif an die AET.
Es geht aber bei diesem Fonds noch weiter, je nach Marktsituation können auch negative Entschädigungen entstehen: Der Photovoltaik-Produzent müsste also bezahlen, wenn er seinen Strom ins Netz einspeisen möchte! Was soll das? Wieso werden die kleinen Photovoltaik-Anbieter mit solchen möglichen Penaltys derart abgeschreckt? Wieso wurden sie offenbar die letzten Jahre hinters Licht geführt, denn diese Regelung wurde erst vor Kurzem kommuniziert und eingeführt? Geht so eine erfolgreiche Energiewende? Rückblickend würde ich nicht mehr in diesem Programm mitmachen. Auf solche “Förderung” kann ich gut verzichten. Lieber würde ich meinen überschüssig selbstproduzierten Strom kostenlos einem gemeinnützigen Zweck zur Verfügung stellen, als hiervon weiter Teil zu sein (eigentlich eine gute Idee, nicht?). Ich werde jedenfalls schauen, wie ich den Eigenverbrauch, wie von der AET empfohlen, noch weiter erhöhen oder eine andere Lösung finden kann, falls ein Ausstieg nicht möglich ist.
6. Der Strommarkt ist für Besitzer von kleinen Photovoltaik-Anlagen von Nachteil.
Offensichtlich sind die kleinen Produzenten Opfer eines teilliberalisierten Strommarktes, der nicht die von der Politik vollmundig angekündigten Vorteile bringt: Der nachhaltige, selbstproduzierte Strom aus Photovoltaik-Anlagen ist auf dem Markt anscheinend nichts wert. Anderseits hat offensichtlich die AET ihren Strom vor 2-3 Jahren zu teuer eingekauft. Soll jetzt die Einspeisung der Kleinen diese Verluste wettmachen? Das wäre nicht zielführend und aufgrund der Mengenmissverhältnisse auch aussichtslos.
Die Frage ist vielmehr, wieso dieser Punkt im Tessin (und generell in der Schweiz) derart ins Gewicht fallen soll, denn die AIL liefert an ihre Kunden gemäss eigenen Angaben primär Wasserkraft oder Kernenergie aus eigener oder Schweizer Produktion. Es wäre also möglich, die Wasserkraft zu drosseln und in den Stauseen zu speichern, wenn genügend Photovoltaik-Strom vorhanden ist. Oder wie der Leser in seinem Kommentar im unten angefügten Artikel richtig anmerkt: Der Hochtarif ist kontraproduktiv und verhindert, dass gerade Photovoltaik-Strom in seinen Spitzenzeiten ungehindert genützt werden kann. Sollen doch alle mitten am Tag waschen, kochen, Autos aufladen, was auch immer, wenn die Sonne scheint. Doch solange die Stromunternehmen nach ihren eigenen Regeln steuern, wird dies verhindert.
Wo ein Wille wäre, wäre auch ein Weg und möglicherweise Platz für innovative neue Ideen. Die AET hat mit ihren Anlagen dieselben Möglichkeiten. Zusätzlich kann Strom aus Photovoltaik-Anlagen mit einem Herkunftsnachweis teurer verkauft werden als nicht nachhaltiger Strom. Die AET handelt bereits mit solchen Zertifikaten.
Der Schluss ist einfach: Die AET macht mit der Nutzung von Strom aus Photovoltaik-Anlagen ihrer kleinen Kunden zwar durchaus kleine Gewinne und gibt diese trotz kantonaler “Förderung” aber nicht wirklich an sie weiter. Sie holt sich ihren Vorschuss über die Jahre wieder zurück. Der Fonds ist mehr Schein als Sein. Ist dieses Geschäft und dieser Teil der Klimainitiativen einfach zu unbedeutend? Anderseits differenziert die AET den eingespeisten Strom nach Quartalen, damit sie in den Sommermonaten den kleinen Produzenten (noch) weniger bezahlen muss. Hier sind offenbar Kräfte am Werk, die die Photovoltaik nicht als Energieträger der Zukunft aufbauen wollen oder das Konzept der dezentralen Stromerzeugung nicht oder nur einseitig verstehen. Denn Geld ist in unserer Gesellschaft die einzig verlässliche Währung für Anerkennung. Hier ist die Anerkennung sehr klein, nämlich 3.2 Rappen.
Ein Wort zur erwähnten “Förderung” von CHF 1’084.-. Die AET empfiehlt in ihrer obigen Antwort den Eigenbedarf zu erhöhen und mit Batterien zu arbeiten. Das haben wir getan. Unsere Autarkiequote liegt im Verbrauch bei hohen 68% (siehe Skizze). Wir erreichen dies durch den Einsatz von Batterien (20 kWh). Die beiliegende Statistik zeigt, dass in den Sommermonaten noch mehr Batterien gefüllt werden könnten.
Aber tatsächlich sensationell ist, dass wir durch die Eigenproduktion über 2/3 des Stromverbrauches einsparen konnten! Würden das alle tun, dann wäre das Energieproblem zu einem guten Stück gelöst. Aus diesem Grund ist natürlich die Maximierung des Eigenverbrauchs ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg. Er war für mich seit jeher Teil der Photovoltaik-Initiative.
Die Anlage speiste im Jahre 2024 1.16 MWh ins Netz und wurde dafür von der AET mit 37.12 Franken entschädigt. Die Liegenschaft bezog aus dem Netz im gleichen Jahr mit 1.36 MWh in der gleichen Grössenordnung Strom und bezahlte dafür 448.80 Franken.
Also: Was will der Staat eigentlich noch mehr von mir? Und zu welchem Preis? Die ganze Anlage mit einer Leistung von 4.92 kWp hat schlüsselfertig CHF 38’000.- gekostet. Massgeblich sind die Kosten getrieben durch die grossen Batterien (ca. CHF 15’000.- bzw. 40% der Gesamtkosten). Die “Förderung” der AET beträgt demnach nicht einmal 3% der Gesamtkosten. Ein Klacks. Und jetzt nur 3 Rappen pro Kilowattstunde? Wieso stossen der Kanton Tessin und die AET die kleinen Photovoltaik-Anbieter derart vor den Kopf? Ich könnte auf “Förderung” verzichten, wenn die Rückvergütung zu akzeptablen Konditionen erfolgen würde. Kleine Photovoltaik-Produzenten benötigen heute keine staatliche Lenkungsmassnahmen mehr, sondern faire Marktbedingungen.
Der Vollständigkeit halber füge ich an, dass ich für meine Anlage ebenfalls von der Pronovo CHF 2’168.- einmalige Förderung erhalten habe. Insgesamt würde dann die Förderung rund 9% der Gesamtkosten ausmachen. Doch habe ich festgestellt, dass bei nationaler Förderung offenbar keine kantonale Förderung möglich ist. Falls ich dies richtig interpretiert habe, müsste ich also den vom Kanton erhaltenen Betrag von CHF 1’084.- wieder zurückbezahlen. Aber dazu laufen die Abklärungen noch. Die gesetzliche Grundlage (Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili RFER) dazu ist sehr schwer zu verstehen. Es ist für mich unklar, was tatsächlich Sache ist. Ich suche immer noch eine eindeutige Erklärung für den in diesem Gesetz oft genutzten Begriff “RIC” (meint wahrscheinlich analog dem EVS das Einspeisevergütungssystem).
7. Was wäre eine faire Rückvergütung?
Fair ist, wenn die Einspeisevergütung grundsätzlich dem am jeweiligen Standort gültigen Strompreis entspricht. Also, wenn wir 33 Rappen für die Kilowattstunde zu bezahlen haben, dann sollten wir auch 33 Rappen für den eingespeisten Strom erhalten. Oder mit einer guten Begründung zumindest einen gleichbleibenden fairen Anteil - z.B 75% vom Strompreis:
Mit den Anschlussgebühren bezahlt jeder Konsument bereits für die Netznutzung. Am Anschlusspunkt der Liegenschaft ist also der Ort der Wahrheit: Dort kostet der Strom einen Preis und zwar unabhängig von der Richtung (ob Verbrauch oder Rücklieferung). Es gibt an diesem Punkt keinen Markt: Der Anbieter ist definiert und macht seinen Strompreis. Konsumenten haben keine Wahl. Der Rest ist Sache des Anbieters. Wenn der Anbieter seinerseits an einem Markt teilnimmt, dann hat er seine Risiken selbst zu tragen. Er kann sie nicht auf die kleinen Anbieter übertragen, die keine Wahl haben. Er hat für Netzstabilität zu sorgen, was nicht Sache der Kleinen ist, sondern sein Auftrag. Wenn der kleine Produzent defacto die 4-fache Batteriekapazität seiner installierten Photovoltaik-Leistung in seinem System integriert hat, dann hat er genügend für die Glättung seines sogenannten Flatterstroms gemacht. Für den Rest haben die Grossen zu sorgen. Wenn ein Kleiner auf Batterien verzichtet, dann soll er auch weniger erhalten, also z.B. 75% des Strompreises, den er im Gegenzug im Verbrauch bezahlen müsste.
Ja, kleine Anlagen sind teuer, haben aber einen entscheidenden Vorteil: Sie erzeugen die Energie dort, wo sie auch mehrheitlich verbraucht wird. Das ist keine Raketenwissenschaft, sondern klug. Die Skalierung erfolgt nicht hierarchisch, sondern in der Breite des Netzes. Damit reduziert sich auch der Druck, veraltete Stromnetze zu überlasten oder teuer sanieren zu müssen. Das muss etwas Wert sein.
8. Gelingt so die Energiewende?
Der Schluss liegt nahe: Der Kanton Tessin betrachtet die Photovoltaik-Anlagen der vielen kleinen Tessiner Photovoltaik-Produzenten als nutzlos und nicht zielführend. Nur wenn die Photovoltaik-Produzenten ihren Strom selbst verbrauchen, sind sie sinnvoll. Andernfalls werden sie zu einem ungeliebten Anhängsel für die AET und damit den Kanton Tessin. Gerade das Tessin, unsere gute alte Sonnenstube steuert die Energiewende in diesem Punkt derart fragwürdig. Die erheblichen Investitionen der vielen Photovoltaik-Produzenten wären damit ein Fehler gewesen. War das die Botschaft vom Bundesrat und dem BfE der letzten Jahre an die Bevölkerung? Ist das der Konsens der Energiekommission UREK?
Diese Haltung führt schliesslich dazu, dass Photovoltaik-Produzenten ihren Strom selbst verbrauchen oder in teuren Batterien speichern und nicht mehr ins Netz einspeisen werden. War das die Idee der Energiepolitik? Sollen Hausbesitzer mit Photovoltaik-Anlagen und hohem Eigenverbrauch dafür sorgen, dass zu schwache Netze der Stromanbieter nicht übermässig belastet und/oder deren falsche Stromeinkäufe kompensiert werden können? Ist es das Problem der Kleinen, wenn die Grossen keine Ahnung oder keine Veranlassung dazu haben, wie sie überschüssigen Strom speichern können? Die Kleinen haben ihren Teil der Vereinbarung eingehalten und sollen jetzt die Versäumnisse der Grossen kompensieren? Wieso wälzen Staatsbetriebe solche Risiken auf ihre Kunden ab, wenn sie eigentlich im Dienste dieser gleichen Kunden stehen und letztlich zumindest indirekt ihren Kunden gehören? Wieso kann die Gemeinde Lugano vom Stromverbrauch der umliegenden Gemeinden profitieren und die AIL ohne jedes unternehmerische Risiko nach Pseudo-Marktregeln spielen lassen, wenn es sich bei der AIL um einen Monopolanbieter handelt?
Fragen, die hier exemplarisch am Fall der AIL SA und der Gemeinde Lugano beziehungsweise an der AET und dem Kanton Tessin grob skizziert und aufgeworfen sind. Bekannterweise präsentiert sich die Situation schweizweit unterschiedlich und ist für die Einzelnen sehr intransparent, zu kompliziert und nicht überblickbar. Doch kann nicht alles mit “Komplexität” abgetan werden. Denn letztlich ist es einfach: Für die Kunden zählt, was sie für die Kilowattstunde bezahlen, die sie verbrauchen bzw. was sie für die Kilowattstunde erhalten, die sie produzieren. Es geht um Nutzen. Der Rest ist egal und Sache des Anbieters.
9. Enttäuschung auch im Aargau.
So schaue ich mir meinen Heimatkanton, den Aargau, genauer: den Ort unseres Firmensitzes in Auenstein näher an. Die Stromanbieterin dort ist also die AEW. Ihre Konditionen präsentieren wie folgt:
Verbrauch (inkl. Mehrwertsteuer):
AEW Classic gültig 2024: Zwischen 31.40 (Niedertarif 20:00 bis 07:00) und 36.86 (Hochtarif 07:00 bis 20:00) Rappen pro Kilowattstunde
AEW Classic gültig 2025: Zwischen 26.14 und 31.54 Rappen pro Kilowattstunde
Veränderungen 2025 zu 2024: Zwischen -16.75% (Niedertarif) und -14.4% (Hochtarif)
Einspeisung (für Private keine Mehrwertsteuer, ohne Herkunftsnachweis (HKN), mit HKN zusätzlich 3 Rappen pro Kilowattstunde ):
AEW Rücklieferung gültig 2024: Zwischen 13.3 (Niedertarif 20:00 bis 07:00) und 15.25 (Hochtarif 07:00 bis 20:00) Rappen pro Kilowattstunde
AEW Rücklieferung gültig 2025: Zwischen 6 und 8.15 Rappen pro Kilowattstunde
Veränderung 2025 zu 2024: Zwischen -54.9% (Niedertarif) und -46.6%
Beim Verbrauch wird der Strompreis um knapp 16% gesenkt. Das ist erfreulich. Die Einspeisevergütung wird jedoch halbiert! In der Tendenz bestätigt sich das Bild auch im Kanton Aargau, wenn auch die Vergütungen höher als bei der AET sind. Insbesondere bleibt zu hinterfragen, wieso die Einspeisung nur die Hälfte vom Verkaufspreis darstellt.
10. Ist die AIL eine gute Alternative zur AET?
Es ist wohl besser, auf die kantonale “Förderung” zu verzichten und direkt an die AIL zurück zuliefern, also in der gleichen Weise wie im Aargau: Direkt zum eigenen Stromanbieter. Also prüfe ich die Entwicklung der Tarife bei der AIL der letzten drei Jahre für kleine Anlagen (<30 kWp).
Leider kommuniziert die AIL offenbar keine direkt vergleichbaren Tarife, sondern die Konditionen der einzelnen Preiskomponenten. Also bleibt als Vergleich nur der tatsächlich in Rechnung gestellte Mischsatz von ca. 33 Rappen pro Kilowattstunde.
Einspeisung (für Private keine Mehrwertsteuer, ohne Herkunftsnachweis (HKN), mit HKN zusätzlich 3 Rappen pro Kilowattstunde):
Tarif für Rücklieferung gültig 2023: 13.80 Rappen pro Kilowattstunde
Tarif für Rücklieferung gültig 2024: 12.00 Rappen pro Kilowattstunde
Tarif für Rücklieferung gültig 2025: 9.19 Rappen pro Kilowattstunde
Veränderung 2024 zu 2023: -13%
Veränderung 2025 zu 2024: -23.4%
Veränderung 2025 zu 2023: -33.4%
Bei der AIL im Tessin sind die Tarife für die Rückspeisung von Photovoltaikstrom etwas höher als beim AEW im Aargau. Doch auch hier erhält der Produzent weniger als die Hälfte, als was er für eine Kilowattstunde in derselben Stunde hätte bezahlen müssen. Die Einspeisung wird über 2 Jahre um 33% schlechter. Unter dem Strich wird die Produktion von Photovoltaikstrom laufend unattraktiver.
Genügt dieser kontraproduktive Meccano, um die Energiesicherheit der Schweiz sicherzustellen? Kann eine Energiewende gelingen, wenn die Grossen die Produzenten von Photovoltaik-Strom am langen Arm verhungern lassen? Wir wollten doch von der Willkür der Öl-Scheichs unabhängig und CO2-neutral werden, die Kleinen haben sich begeistern lassen, und jetzt entpuppen sich die hiesigen grossen Akteure im Stromumfeld als die kontraproduktiven Lenker im Hintergrund? Welche Politik unterstützt dieses als Willkür empfundene Gehabe?
Im Vergleich mit der AIL muss sich die AET die Frage gefallen lassen, wieso sie für die Rücklieferung im Jahre 2024 nur einen Viertel des Vergütung für die Kilowattstunde entrichtet, wie es die AIL am gleichen Ort tut. Aufgrund des aktuellen Kenntnisstandes würde ich heute die Einspeisung bei der AIL vornehmen und von diesem fragwürdigen FER des Kantons Tessin die Finger lassen.
11. Das Lebenselixier Energie.
Wenn ich über Energie schreibe, dann treibt mich jeweils der Gesamtkontext: Jeder Mensch benötigt Energie, damit er leben kann. Die Gesellschaft benötigt Energie, damit sie funktionieren kann. Wohlstand, sozialer Frieden und Entwicklung sind direkt mit Energie gekoppelt. Energie ist der Ursprung allen Lebens. Ohne Energie kommt der Tod. So einfach ist das.
Der gesunde Menschenverstand folgert daraus, dass Sorgfalt im Umgang mit diesem Thema vital ist. Sorgfältig heisst in diesem Zusammenhang, dass eine Energiepolitik gut überlegt sein will. Es heisst, dass eine Energiestrategie schlüssig und damit nachvollziehbar einfach sein muss. Schlüssig heisst, dass ihr Vorgehen zum einen klar aufzeigt, welche Energieformen zukünftig neu und welche Energieformen weiterhin Bestand haben und welche Energieformen zukünftig abgelöst werden sollen. Schlüssig heisst auch, welchen Beitrag jeder einzelne, Grosse und Kleine, leisten müssen, damit das Gesamtresultat letztlich stimmt. Über die Absichten muss konsequente Transparenz herrschen. Energiepolitik ist keine Hüh-und-Hott-Politik, weil Energiesicherheit neben Innovation und Bildung wohl der entscheidendste langfristige Standortfaktor für die Schweiz als rohstoffarmes Land ist.
12. WAS, WIE und WARUM entscheiden.
Klar heisst, dass das beschriebene Zielbild mit dem prognostizierten Bedarf der Gesellschaft übereinstimmt und die Energiesicherheit in der Schweiz zu akzeptablen Preisen langfristig sichergestellt ist. Es muss klar sein, WAS damit erreicht werden soll.
Das Zielbild allein reicht nicht. Die Problemlösung umfasst primär das WIE, mit dem dieses Zielbild erreicht werden soll. Es geht darum, wie die angestrebte Veränderung für alle verträglich erfolgen kann, Grosse und Kleine, und wie sie finanziert werden soll. Es kann nicht sein, dass sich die einen, die Grossen, defacto staatsfinanzierte Boni verteilen und die anderen, die Kleinen, die vom Bund geforderten Pionierprojekte aus der eigenen Tasche finanzieren müssen.
Schliesslich muss ein überzeugendes WARUM formuliert sein, wieso dieser Veränderungsbedarf nötig ist. Denn der Mensch mag keine ihm aufgezwungenen Veränderungen. Er ist eine Routinewesen. Seine Urveranlagung fusst darauf, sorgsam mit seinen Ressourcen umzugehen. Daher vermeidet er unnötige Veränderungen und Anstrengungen, weil dies zusätzliche Ressourcen benötigt, die möglicherweise plötzlich nicht mehr vorhanden sind.
Das WAS, das WIE und das WARUM müssen überzeugend sein, denn in der direkten Demokratie müssen die Menschen zustimmen. Es sind die Kleinen, die letztlich entscheiden. Sonst wird die Veränderung von der Mehrheit abgelehnt, sei sie für die Minderheit noch so wichtig. Haben wir je solchen Strompreisen, solchen Marktverzerrungen und komplizierten Konstrukten zugestimmt?
13. Energiepolitik ist seit Jahren nicht zielführend.
Die Energiepolitik der Schweiz der letzten Jahre - primär geprägt durch eine unausgereifte und unprofessionell nationale Energiestrategie sowie durch regional geprägte und suboptimierte Energiekonzepte - hat diese drei Komponenten offensichtlich nicht oder ungenügend berücksichtigt. Diese These findet sich detailliert in den folgenden Artikeln aufgearbeitet und dargelegt (sie seien zur Lektüre empfohlen):
Schweizer Stromgesetz - besser wenig als nichts? (April 2024)
Nichtstun bis Lichter löschen. (Oktober 2023)
Revision der Energiestrategie ist überfällig. (März 2023)
Gesamtbetrachtung der Energiesituation in der Schweiz. (Februar 2023)
14. Gesellschaft ist gespalten.
Dieses Versäumnis einer schlüssigen Gesamtstrategie spaltet die Gesellschaft, und zwar je länger, je mehr. Oberflächlich erkennbar an den Verbrenner-Fans und den Tesla-Jüngern. Doch die Gräben sind deutlich tiefer als die Auseinandersetzung zweier Fangruppen.
Vielmehr wird eine Deadlock-Situation in der Energiepolitik spürbar. Die grossen Projekte sind blockiert. Die Grünen widersprechen sich selbst (z.B. Naturschutz versus Photovoltaik in hochalpinen Regionen) und sehen in ihrer Verhinderungspolitik die Deindustrialisierung als Mittel zum Sturz des Kapitalismus (!). Die Öl-Fraktion sieht Morgenröte am Horizont, gleichzeitig hat die Deindustrialisierung im Wirtschaftsmotor Deutschland eingesetzt. Die Schweiz wird als grosse Zulieferin erheblich mitleiden. Atomkraft - die einzige schlüssige CO2-neutrale verlässliche Energieform zumindest in der heutigen Zeit - wird weiterhin dämonisiert und seit Jahrzehnten systematisch vernachlässigt. Parallelen zu den Versäumnissen in der Sicherheitspolitik und Landesverteidigung springen geradezu ins Auge. Mehr Ernsthaftigkeit und weniger Dekadenz wäre angesagt. Der Bundesrat hat die letzten 20 Jahre viel Verantwortung für diese vertrackte Situation auf seine Schultern geladen. Ideologie, Emotionen und Unvermögen dominieren zu oft die politische Diskussion. Vernunft und Sachverstand bleiben auf der Strecke. Es ist doch so: Die Schweizer Energiepolitik ist in der Sackgasse. Sie ist gescheitert und bestenfalls noch ein sehr holperiges und möglicherweise zukunftsuntaugliches Flickwerk.
15. Energiepolitik ohne Plan.
Sind wir mit der Energiewende einen vitalen Schritt weitergekommen? Nein, natürlich nicht. Das forcierte Verbrenner-Aus ist in Europa ein wirtschaftliches, gesellschaftliches und politisches Desaster mit noch nicht abschätzbaren Konsequenzen für Gesellschaft und Klima. Parallelen zum überhasteten Atomausstieg sind frappant. Die Subventionspolitik für erneuerbare Energien hat nicht zu deutlich günstigeren Anlagen geführt, sondern zu einer blossen Verschiebung der Kosten mit anderen Profiteuren und jetzt zu einem Strömungsabriss bei Elektromobilität. Die Photovoltaik in der Breite ist jetzt mit den zu tiefen, ja unfairen Einspeisevergütungen gerade im Begriff abgewürgt zu werden. “Auf jedem Dach eine Photovoltaikanlage” ist bloss eine Worthülse, ein blöder Politikerspruch. Keine Idee ist vorhanden, wie das Stromspeicherproblem landesweit gelöst werden soll oder mit welchem Strom all die neuen Elektroautos fahren sollen. Kein schlüssiger Plan für die Sicherstellung einer nachhaltigen Energiesicherheit ist erkennbar. Sind jetzt jene die Verlierer, die in den letzten Jahren dem Aufruf der Politik, Regierung und Behörden gefolgt sind und ihre eigenen erheblichen Mittel in Photovoltaik und Elektromobilität investiert haben?
Wo sind hier die Antworten, Herr Bundesrat?
Denn es gibt sie, die Gewinner: Die Stromproduzenten haben gut gewirtschaftet. Die Axpo weist 2023/2024 das zweitbeste Geschäftsjahr aus und zahlt unangebracht übertriebene Boni aus. Christoph Brand, CEO der Axpo, erhielt für dieses Geschäftsjahr einen Fixlohn von 884'000 Franken und einen variablen Lohn (Bonus) von 649'000 Franken. Das ist angesichts der offensichtlich überhöhten Strompreise bzw. der lächerlichen Einspeisevergütungen nicht nachvollziehbar. Auch die Axpo ist ein staatseigener Betrieb, wie die Besitzverhältnisse zeigen. Es ist erstaunlich, ja inakzeptabel, dass die Kantonsregierungen das Axpo-Management offensichtlich weiter gewähren lassen. Freut sich der Staat insgeheim, wenn ihm seine Unternehmen Gewinne abliefern?
Und es gibt die Bisherigen. Staatsnahe Unternehmen, die weiterhin auf regionale Besitzstandswahrung optimieren und die Interessen ihrer Besitzer-Kantone und -Gemeinden mit aller Macht durchsetzen. Es sind die staatlichen Interessen, die sie verfolgen. Nicht die Privatwirtschaftlichen und damit nicht die Interessen der Bürgerinnen und Bürger. Ich streiche es klar heraus: Das ist an sich nicht falsch, denn es ist eine Frage des Standpunktes und der Rahmengebung, die die Staatlichen zu verfolgen haben. Darin optimieren sie sich im Sinne der staatlichen Vorgabe. Sie optimieren nicht die Situation einzelner Bürgerinnen und Bürger. Erst wenn die Gruppe dieser Bürgerinnen und Bürger grösser als die Mehrheit wird, dann kann sie in der Demokratie die Vorgabe an die Staatlichen ändern und Einfluss nehmen. Dazu müssten die Gruppe der Stromverbraucher oder der Stromeinspeiserinnen organisiert sein, was natürlich nicht der Fall ist.
Als Anekdote doch noch der gute alte Benzinpreis: Bei einem aktuellen Benzinpreis von CHF 1.74 (TCS, Ende 2024) und der Mehrwertsteuer von 8.1% (Avenergy Suisse) machen die 77 Rappen Mineralölsteuer rund 48% aus. Die Konsumenten bezahlen also mit jedem Liter satte 56% an Steuern an den Staat. Beim Strom sind wir jetzt in derselben Grössenordnung. Doch: Hätte nicht der Strom zur Energieform der Zukunft werden sollen?
16. Die Kleinen sind die Lackierten.
Das Problem des Ganzen? Die Kleinen sind die Dummen. Die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes sind die Lackierten. Die kleinen Stromverbraucher und Stromproduzenten haben keine politische Lobby, die glaubhaft und nachhaltig ihre Interessen vertritt. Oder wer wäre das denn in unseren Regierungen und Parlamenten?
So geht das nicht. Letztlich stehen die Grossen im Dienste der Kleinen und nicht umgekehrt. So ist das in einer Demokratie. Die Grossen müssen sorgfältiger mit den Kleinen umgehen. Sonst verliert das Land nicht nur die Unterstützung vieler Solar-Pioniere, sondern generell der Kleinen. Die Grossen - Staat und staatsnahe Betriebe - würden damit die Energiewende scheitern lassen. Das ist Schlimmste, was passieren kann: Schiffbruch auf halber Reise führt zum Untergang. Es ist Konsens über die Energiezukunft nötig. Nicht zwischen Jungkommunisten und Rechtspopulisten. Nicht zwischen Links, Mitte und Rechts. Sondern zwischen den Kleinen und den Grossen. Nur ihre Einigkeit kann in diesem Thema die Energiezukunft wieder strahlen lassen.
Es läuft etwas schief. Herr Bundesrat, übernehmen Sie bitte!
17. Epilog.
Ich weiss, ich schreibe hier aus der Sicht eines Photovoltaik-Pioniers möglicherweise etwas pointiert. Die Freude an der Sache bleibt aber ungebrochen. Doch ich wüsste jetzt nicht, ob ich nochmals diese für mich sehr hohen Beträge in Photovoltaik und Elektromobilität investieren würde, denn ich weiss ja nicht, wohin diese - ich kann es nicht anders nennen - Willkür der Grossen noch führt. Gleich wie die Negativzinsen - mögliche negative Einspeisevergütung haben gerade bei den sicherheitsbewussten Menschen einen einschneidenden Vertrauensverlust verursacht. Die Börse verstärkt ihn auf ihre Weise: Nachhaltig motivierten Aktien sind seit Längerem ein Verlustgeschäft, manche ein Totalausfall. Aber mein Polestar 2 ist eine Bombe. Den gebe ich nicht mehr her. Er ist wohl mein bestes Fahrzeug, dass ich in den letzten 44 Jahren gefahren bin.
Gerade als Interessierter verstehe ich die Signale durchaus: Das Pendel schwingt zurück. Viele meinen, zurück zur Vernunft. Ich meine, hin in die Ungewissenheit und labilen Zustände. Denn die alten Rezepte taugen in der Energiefrage nicht. Wunschdenken schon gar nicht. Es ist nicht Schwarz oder Weiss, Öl oder Elektro. Es ist die Kombination aus dem bewährten und zukunftsfähigen Bestand und dem nötigen zukunftsträchtigen Neuen, die den Erfolg bringen wird. Eine schlüssige Energiestrategie eben. Da könnte ich helfen. Es ist keine Raketenwissenschaft.
Zurück zum Tessin. Es schmerzt schon ein wenig, wenn dieser schöne und sonnige Kanton gerade bei der Energiewende im dargestellten Punkt derart kontraproduktiv steuert. Ich habe ihn immer als fortschrittlich, verantwortungsbewusst und ernsthaft in der Materie erlebt. Der beiliegende Artikel aus der Tessiner Zeitung zeigt mir, dass dies immer noch der Fall ist. Aber der Teufel steckt manchmal im Detail, wie hier bei der Einspeisevergütung und den Konditionen der kantonalen Förderung. Ich würde mich freuen, wenn dieser Erfahrungsbericht dazu beitragen kann, dass diese Situation wieder korrigiert werden kann.
Artikel in der Tessiner Zeitung vom 7.2.2025 von Antje Bargmann zum kantonalem Energie- und Klimaplan des Kantons Tessin.
P.S.
Zum Bild: Im Dezember gastiert jeweils der Circus Knie in Agno. Es ist der Abschluss seiner Saison. Im Gegensatz zur traurigen Energiepolitik eine fröhliche Geschichte.
Der aktuelle Artikel der Aargauer Zeitung zum Thema ist empfehlenswert.
Die Grünliberalen tun etwas für faire Einspeisevergütungen. Hier mitmachen.
Der Bundesrat hat am 19.2.2025 eine minimale Einspeisevergütung entschieden.
Schweizer Stromgesetz - besser wenig als nichts?
Die Schweiz stimmte am 9. Juni 2024 über das Stromgesetz ab. Die SVP nimmt die Gegenposition ein. Zu Recht?
(c) 2016: Kraftwerk Rupperswil-Auenstein, Aare, Kanton Aargau, Schweiz, Foto: Roland Voser.
Revision der Energiestrategie ist überfällig.
Die Schweiz steht vor dem energiepolitischen Wendepunkt. Die Energiestrategie 2050 liefert auf die vielen offenen Fragen nicht die nötigen Antworten.
(c) 2019: Abendblick zum Monte Rosa von Cademario, Kanton Tessin, Schweiz. Foto: Roland Voser
Gesamtbetrachtung der Energiesituation in der Schweiz.
Die Einschätzung der Energiepolitik bildet Grundlage für den Einstieg in Photovoltaik mit ihrer dezentralen Energiesicherheit.
(c) 2018: Sonnenaufgang, Weinberg Cantina Monti, Cademario, Malcantone, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser
smartmyway zuhause.
(c) 2024, Dezemberstimmung in Agno mit dem Circus Knie, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser.
Seit 2018 Chief Editor, Mitbegründer, Verwaltungsrat und Teilhaber von smartmyway, Autor, Coach, Mentor und Berater. Vorher als Geschäftsführer von Media Markt E-Commerce AG, Media Markt Basel AG, Microspot AG sowie in den Geschäftsleitungen von Interdiscount AG und NCR (Schweiz) AG tätig. Heute Digital Business Coach und Schreiberling.
Experte für Digitalisierung, Agile SW-Entwicklung, Digital-Business, Handel, Sales & Marketing, E-Commerce, Strategie, Geschäftsentwicklung, Transformationen, Turn Around, Innovation, Coaching, erneuerbare Energien, Medien, Professional Services, Category Management, Supply Chain Management