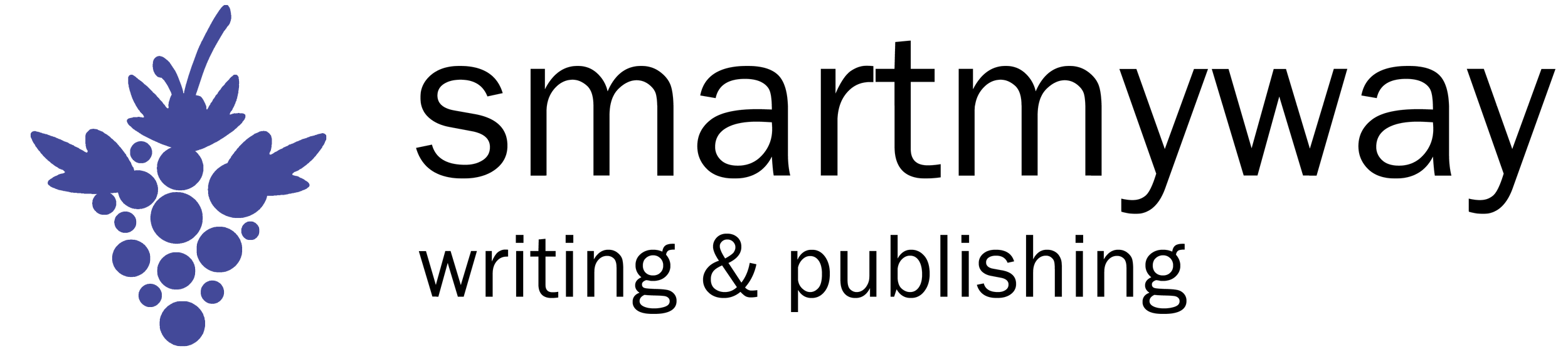Inhalt
Kapitel 1
Vorspiel
Es beginnt mit einem Schlußstrich
Kein Haus zu verkaufen – oder doch?
Hexenzauber?
Ganz einfach ist es nicht
Kathrin mit der Maurerkelle
Kapitel 2
Michelangelo
Michelangelos Umzug
Fräulein Susi Stäubli
Die Ureinwohner melden sich
Maiskorn und Kaffeebohne
Kapitel 3
Mai
Mein Einzug in den Dschungel
Ugo der Weise
Heinis Désirées
Noch eine Hexe
Juni
Das Quellchen
Die Notfallapotheke
Kapitel 4
Juli
Der Esel und die Gärtnerin
Strafe
Unsere Freiluftküche
Kapitel 5
August
Wilhelm Tell auf dem Monte Valdo
Die Regenküche
Mein Onkel Arthur
Kapitel 6
September
Eine Bank kracht
Der große Kriegsrat tagt
La vera marmellate del Monte Valdo
Oktober
Die vergessenen Désirées
Und nach der Konfitüre die Pornographie
Wir säten nicht und ernteten doch
Kapitel 7
November
Spinat, die Pille und noch ein Abschied
Ich und die Stadt
Der schöne Vorrat
Wir fällen Holz und haben Sorgen
Dezember
Gedanken und Gespräche
Die echten Marrons glacés vom Monte Valdo
Wie Michelangelo Michelangelo wurde
Das Nachtmahl des Jahrhunderts
Sie bezahlen, was Sie wollen.
Auf dieser Seite können Sie das Buch Kleine Welt im Tessin kostenlos lesen. In jener Schreibe, wie es die Autorin 1974 verfasst hatte. Wir veröffentlichen zum Start jede Woche ein neues Kapitel. Sie entscheiden, wie Sie die weitere Verlagsarbeit von smartmyway unterstützen möchten. Sie haben die Wahl:
Sie lesen das Buch kostenlos, freuen sich daran und empfehlen uns weiter.
Sie lesen das Buch kostenlos und tragen sich in unserer Leserliste ein, damit wir Sie über unsere Aktivitäten informieren können.
Sie lesen das Buch und spenden uns einen Betrag, den Sie für angemessen halten.
Sie lesen das Buch, indem sie es bei Amazon oder bei uns im Verlag für sich selbst oder zum Verschenken kaufen.
Mit herzlichen Tessiner Grüssen!
Roland Voser & Maurizio Vogrig
Verleger smartmyway
Cademario im Frühling 2025
Vielen Dank, dass Sie uns unterstützen!
Ich möchte freiwillig etwas bezahlen.
Wir freuen uns über jeden Betrag, mit dem Sie unsere Arbeit unterstützen möchten.
Hier ist der Einzahlungsschein für Ihre Spende für die Kleine Welt im Tessin.
Schreiben Sie uns bitte, damit wir uns bei Ihnen bedanken können. Herzlichen Dank!
Ich möchte das Buch in klassischer Form lesen.
Wir freuen uns über Ihren Kauf bei Amazon. Innerhalb der Schweiz liefern wir auch direkt vom Verlag.
Die Tessiner Tagebücher von Kathrin Rüegg.
In den letzten 5 Jahren hat der Schweizer Verlag smartmyway in vielen unentgeltlichen Stunden Kathrin Rüeggs Bücher neu aufgelegt, weil die lebensbejahenden Geschichten dieser bemerkenswerten Unternehmerin aktueller denn je sind und ein neues Publikum erreichen sollen.
Der Verlag präsentiert 2025 dieses ideelle Projekt erstmals komplett mit den neun Tessiner Tagebüchern in Taschenbuchform als Einzelbände und in drei Sammelbänden, sowie den zwei dazu gehörenden Bildbänden. Sogar eine englische Version gibt es jetzt vom ersten Band.
Kleine Welt im Tessin von Kathrin Rüegg.
Erstes Tessiner Tagebuch.
Ein Lesebuch von smartmyway.
Kapitel 1.
Für Michelangelo.
Ohne ihn würde der Monte Valdo auch heute schlafen.
So schlummert er nur noch.
Alle beschriebenen Orte und Personen existieren, doch wurden ihre Namen zum Teil verändert.
Susi Stäubli, Bimbo Seidenglanz, Grano und Bona heißen wirklich so.
Vorspiel
Es beginnt mit einem Schlußstrich
Am dreißigsten April neunzehnhunderteinundsiebzig, abends um zehn Uhr vierundzwanzig, beschloss ich, mein Leben zu ändern.
Ich war einundvierzig Jahre alt, ledig, gesund, etwas zu dick, hatte eine Manie, alles in genaue Zahlen oder Listen zu fassen, ließ mir meine Haare rotblond färben und galt mit meinem stadtbekannten Einrichtungsgeschäft als gutverdienende Karrierefrau.
Aber ich hatte genug!
„Genug haben“ hat zwei ganz verschiedene Bedeutungen, je nachdem man das erste oder das zweite Wort betont.
Ich hatte genug von der Hetze nach mehr und mehr Geld. Immer höhere Mietzinsen, die steigenden Löhne für meine sechs Angestellten und meine jedes Jahr luxuriöser werdende Lebenshaltung zwangen mich zu bald unerträglichen Arbeitsleistungen.
Ich hatte auch genug von verstopften Autostraßen, überfüllten Parkplätzen, zu rasch eingenommenen Mahlzeiten in verrauchten Restaurants, von nach Benzin und Öl stinkender Luft, von hastenden Menschen und zuckenden Leuchtreklamen.
So setzte ich mich an jenem Abend hin und notierte mir auf einem Zettelchen, worauf ich eigentlich verzichten könnte. Das Zettelchen habe ich immer noch, und die einzelnen Punkte stimmen auch heute. Ich kann entbehren:
• Leben in der Stadt im allgemeinen
• Elegante Kleider
• Friseur
• Kosmetiksalon
• Teures Auto
• Flugreisen
• Hotelferien
• Reiten und Skifahren
• Kino
Wenn ich ganz einfach lebte, hatte ich genug finanzielle Mittel, um meinen Traum zu verwirklichen. Seit mehr als einem Jahr besaß ich einen kostbaren Schatz, der darauf wartete, daß ich ihn endlich hebe – den Monte Valdo!
Kein Haus zu verkaufen – oder doch?
Eigentlich sollte ich es niemandem verraten: Ferien im Acquaverde-Tal sind zu jeder Jahreszeit ein ganz einmaliges Erlebnis.
Seit acht Jahren floh ich bei jeder Gelegenheit aus der Stadt nach Froda, in mein Tessiner Dorf. Alle sechsundzwanzig Einwohner kannten mich so gut, daß sie mich „er Caterina“ – die Kathrin – nannten. Ich wußte von den meisten nur den Vornamen und lernte an langen Winterabenden am Kaminfeuer ihre Lebensgeschichten kennen.
Seit etlichen Jahren schon wollte ich irgendwo in der Gegend eines der alten Häuser kaufen. Aber das ist gar nicht so einfach. Wohl sind viele Dörfer halb ausgestorben, weil ihre Bewohner vor zwanzig, dreißig und noch mehr Jahren nach Übersee auswanderten, doch die Besitzer der alten Gebäude ausfindig zu machen, ist enorm schwierig. Durch Erbteilungen gehören zum Beispiel die Küche und das Wohnzimmer eines Hauses der Giuseppina in Pasadena, der Keller dem Rico in Montevideo und die Schlafzimmer dem Silvio. Er lebt hier im Dorf und möchte seinen Hausanteil gerne verkaufen.
Nach zwei Jahren vergeblicher Suche dachte ich kaum mehr an meine Pläne.
In der Stadt tobte der Karneval. Ich verzog mich nach Froda. Dort wohne ich stets bei Maria, die ein paar Fremdenzimmer vermietet und Wintergäste am liebsten sieht. Die bringen gefundenes Geld, denn im Sommer ist ohnehin jedes Bett im Tal besetzt.
„Du hast Besuch“, rief sie mich schon früh am ersten Morgen. „Guido will dich sprechen.“
Guido war in jungen Jahren Holzfäller, wanderte nach Amerika aus und machte dort ein kleines Vermögen. Nach Froda heimgekehrt, bezog er eine Versicherungsrente und vertrat eine Bierbrauerei. Er war wortkarg, hatte krauses Grauhaar und wachsame, ein bisschen misstrauische Augen. Seine im ganzen Dorf bekannte Vorliebe für Geheimnistuerei machte ihn oft unbeliebt. Wir zwei kamen gut miteinander aus, weil ich ihm seine Geheimnisse ließ und nicht viel fragte.
„Du mußt gute Schuhe und alte Kleider anziehen und mitkommen. Ich habe eine Überraschung für dich.“ Ich gehorchte. Maria schalt mich, weil ich fortging, ohne den Frühstückskaffee auszutrinken.
Wir bestiegen „la mia Peschù“, wie Guido seinen klapprigen Peugeot stets zärtlich nannte, und fuhren talabwärts. In San Michele zweigten wir wieder gegen den Hang ab, durchquerten ein paar Dörfchen. Das Auto keuchte über ein kleines Sträßlein unzähligen Kurven entlang durch einen immer dichter werdenden Kastanienwald aufwärts, aufwärts, aufwärts – fast bis in den Himmel.
Wir überquerten die Brücke des Valle della Colera – des Choleratals – und langten bald auf einer kleinen Ebene an. Dort bog Guido von der Straße ab und hieß mich aussteigen. Er drückte mir ein sichelartiges, schweres Messer – eine Falce – in die Hand und stapfte über einen kaum erkennbaren Fußweg durch raschelndes, hellbraunes Laub schräg abwärts in den Wald. Es standen Kastanien darin, so dick, daß drei, vier erwachsene Personen nötig gewesen wären, um ihren Stamm zu umarmen. Die Bäume waren teilweise hohl und hätten spielenden Kindern herrliche Verstecke für spannende lndianerkämpfe geboten.
Der Weg wandte sich in einer scharfen Kurve zurück in die Richtung gegen das Valle della Colera, ging zwei oder dreihundert Meter fast geradeaus dem Hang entlang. Unter mir sah ich durch die Baumstämme die grauen Granitdächer einiger Häuser schimmern.
Unser Pfad wurde steinig, links stiegen mächtige Felsbrocken auf. Wir gingen im Zickzack abwärts und schließlich auf einem letzten, wiederum waagrechten Stück geradewegs auf die Häuser zu.
Meine geheime Hoffnung schien sich zu erfüllen. Guido brachte mich zu einem verkäuflichen Haus. Aber ich mußte meine Ungeduld noch eine ganze Weile zügeln. Der letzte Wegrest war zugewachsen mit einem gut zwei Meter hohen Gewirr von Brombeerranken und Ginster. Ginsterholz ist entsetzlich zäh, und trockene Brombeerdornen stechen grausam. Wir schlugen mit unseren Falci einen Durchgang und gelangten mit zerrissenen Kleidern und zerrauften Haaren auf einen kleinen, von vier Gebäuden umgebenen Platz.
Guido stieg über ein Treppchen zur Türe des Hauses, das die Jahrzahl 1794 trug. Er begann, die aus ungemörtelten Steinen gefügte Mauer abzutasten.
„Rechts von der Türe in der Mauer gegen Bellinzona, hat sie gesagt“, murmelte er. Er zog hie und da ein Steinchen aus der Mauer. Nach einigem Suchen hielt er mir einen riesengroßen, rostigen Schlüssel unter die Nase.
„Ecco, da wäre er.“
Er steckte ihn ins Schloss und drehte ihn mit einiger Kraftanstrengung. Dann mußte er einen Bolzen lösen und einen fast halbmeterlangen, dicken Eisenriegel zurückziehen. Erst jetzt ließ sich die Türe aufstoßen. Sie knarrte und knirschte.
An der gegenüberliegenden Wand des großen Raumes war ein Kamin. Eine Kette hing darin. Es standen zwei rußige Polentapfannen da, vier oder fünf Zoccoli lagen herum und eine vergilbte Zeitung mit dem Datum 29. September 1928. In einem Winkel standen zwei mit Heu gefüllte Betten.
Mehr konnte ich nicht erkennen, denn Decke und Wände waren schwarz von Ruß und Alter. Die Fenster waren mit Spinnweben so dicht verhüllt, daß eigentlich nur die offene Türe Licht spendete.
Guido kramte, während ich mich umschaute, in einer Ecke herum und hielt schließlich einen ganzen Bund dieser großen Schlüssel in der Hand.
„Nem – komm!“
Ich sagte nichts, ging nur folgsam hinter ihm drein und staunte.
Im untern Haus gab es ebenfalls einen Raum mit Kamin, hübsche kleine Nischen in den Mauern, eine lange, dunkle Truhe, ein sehr breites und sehr kurzes Bett aus dicken Holzbohlen. Oben war ein Heuboden, den man wegen der Hanglage des Hauses von außen ebenerdig betreten konnte, unten ein schöner, gewölbter Keller, in dem Fässer in Reih und Glied standen.
Im gegenüberliegenden, langgestreckten Haus war wieder ein solcher Keller, im oberen Geschoß fanden sich zwei Räume. Die Bodenbretter des Dachstocks hatten Löcher. Wir wagten nicht, ihn zu betreten. Schade, hier war auch das Dach nicht mehr dicht.
Das vierte Gebäude war ein geräumiger Stall, zu dessen Heuboden eine Außentreppe führte.
Welches Haus war hier wohl verkäuflich? Jedes hatte seinen besonderen Reiz. Ich wußte gar nicht, für welches ich mich entscheiden würde, hätte ich die Wahl. Am schönsten wäre es, wenn man gleich das ganze Weilerchen kaufen könnte. Welch herrliche Feriensiedlung für stadtmüde Menschen würde das geben!
„Und jetzt mußt du das noch anschauen“, wies mich Guido an. Er machte mit der Hand eine umfassende Bewegung über die ganze Gegend.
Da staunte ich noch mehr. Vor lauter Kampf mit dem Gestrüpp und Neugier auf die Häuser hatte ich die Aussicht überhaupt nicht beachtet. Und dabei war sie einfach umwerfend. Wir waren auf einer Bergterrasse gegenüber dem Monte Ceneri. Links sah ich durch die nackten Baumstämme weit unten die Burgen und Mauern von Bellinzona, rechts den Lago Maggiore. Die Spitzen der gegenüberliegenden Berge waren mit Schnee überzuckert. Die Abhänge leuchteten in der Februarsonne hellbraun und grau. Dort, wo die Sonnenstrahlen nicht hintrafen, lagen dunkelblaue Schatten.
Die vier Häuser kuschelten sich in die Ecke einer großen Wiese. Deren stufenförmige Anlage ließ erraten, daß hier einst ein Weinberg gewesen war. Jetzt war alles bedeckt mit honigfarbigem, dürrem Farnkraut.
Wir setzten uns auf die Treppe zum Heuboden des Stalles.
„So, jetzt hast du‘s gesehen“, sagte Guido. „Möchtest du es kaufen?“
„Was?“, fragte ich. „Welches Haus ist denn zu haben?“
Guido machte nochmals eine sehr umfassende Gebärde und zählte auf: „Die vier Gebäude, fünfzehntausend Quadratmeter Weinberg und fünftausend Quadratmeter Kastanienwald.“
Ich schluckte leer und schloss die Augen. Quadratmeter und Häuser und Ställe und Schlüssel und Zoccoli und Polentapfannen wirbelten in meinem Kopf herum.
Das war viel zu schön. Aber eigentlich brauchte ich nur ein Haus, nicht vier, und überhaupt – das würde ich nie bezahlen können.
„Wieviel?“ Das kam sehr zaghaft.
„Zehntausendneunhundert Franken. Die neunhundert kannst du noch abmarkten. Sie sind dafür eingebaut.“
Ich schluckte nochmals und brauchte einige Zeit, um mich zu fassen.
„Aber wieso ist das denn so billig? Würde man diese Häuser heute mit so schönen Bruchsteinmauern bauen und mit Steinplatten decken, die zehnfache Summe würde nicht ausreichen.“
„Typisch Frau“, brummte Guido, „sieht die Nachteile nicht.“ An seinen klobigen Fingern zählte er auf:
„Erstens hat das Dorf keine Autozufahrt. Eine Straße zu bauen, wäre in dem steilen Gelände sehr teuer, obschon sie nur etwa sechshundert Meter lang sein müsste. Zweitens hat es keinen elektrischen Strom.
Und drittens und das ist der größte Haken – hat es kein Wasser. Da war eine Quelle, aber der Brunnen ist vor mehr als fünfzig Jahren versiegt. Der damalige Besitzer baute sich dann diese Wasserzisterne, die durch das von den Dächern abfließende Regenwasser gespeist wurde.“
Er deutete auf ein gemauertes Viereck neben dem Stall, etwa vier Meter lang und drei Meter breit. Der unten angebaute Brunnentrog ließ vermuten, daß es gut zwei Meter tief war. Dann hätten also etwa zwanzig Kubikmeter Regenwasser darin Platz.
Guido erläuterte weiter: „Zum Tränken des Viehs und zum Bewässern des Weinbergs genügte das. Und das Trinkwasser? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich tranken sie eben Wein.“
Wir schwiegen ein Weilchen. Die Sonne schien warm auf mein kleines Paradies. Ich schaute auf den Wald unter mir. Es waren nicht nur Kastanienbäume da, auch Eichen, Linden, Nussbäume und Birken. Mitten im Weinberg standen ein Apfel-, ein Feigen- und zwei Kirschbäume.
Unterhalb des Stalles, dort, wo der Misthaufen war, würde ich den Garten anlegen.
Ich sah Ziegen grasen und hörte Hühner gackern. Ich sah auch blaue Trauben unter rotem und gelbem Weinlaub, braungebrannte Feriengäste, die sich wohlig unter bunten Sonnenschirmen räkelten.
Wie lange unser Schweigen dauerte, weiß ich nicht. Ich wußte damals auch nicht, wie sehr sich mein Leben durch meinen Entscheid ändern würde. Aber ich hatte mich entschlossen.
„Ich kauf‘s“, sagte ich. „Und ich bezahle die gesamten zehntausendneunhundert Franken. Soviel ist es mir wert.“
Damals wußte ich noch nicht, wieviel neunhundert Franken wert sein können.
Beim Abschluss des Kaufvertrages mit Guido und seiner Schwester, die das Gut von ihrem Onkel Delio in Amerika geerbt hatten, erfuhr ich den Namen meines Dorfes: „Monte Valdo“.
Hexenzauber?
Bald waren meine Ferientage vorbei. Ich kehrte zurück in die Stadt, flog nach Frankfurt an die Frühjahrsmesse, nach Paris an den Salon des Ateliers d‘Art und an die Möbelmesse. Ich erhielt den Auftrag zur Einrichtung der Räumlichkeiten eines Golfklubs, dann eines Hotels in Klosters und schließlich eines Hotels in Locarno.
Mein Weilerchen schlief unterdessen weiter. Es wurde Spätherbst, bis ich mit Silvia nach dem Monte Valdo fahren konnte. Silvia war in Froda eine Art Dorfhexe, die aus der Hand lesen, mit dem Pendel verlorene Dinge suchen und mit der Rute verborgene Wasserströme feststellen konnte. Warum sollte sie nicht meine versiegte Quelle finden?
Silvia schnitt ihre Rute von einem Haselstrauch: eine Astgabel. Das unverzweigte Stück war etwa zwanzig, die vergabelten Enden etwa dreißig Zentimeter lang. Geheimnisvoll sah das aus, wie die alte Frau mit dem tief über das Gesicht gezogenen Kopftuch über die Weinberg-Wiese ging, einen Fuß ganz nah vor den andern setzend. Sie hielt die Rute mit nach oben gekehrten Handflächen an den beiden Gabeln, das unverzweigte Stück ragte waagrecht geradeaus. Nachdem sie ein gutes Drittel der Wiese überquert hatte, senkte sich die Rutenspitze, wie von einem unsichtbaren Faden gezogen, nach unten. Silvia ging im gleichen Schritt weiter. Die Rute hob sich wieder, ging nach einem weiteren Meter wieder nach unten, hob sich wieder, im ganzen viermal.
„Hier hast du vier Wasserstränge für deinen Brunnen!“, rief sie, „oder ich fresse den Besen, auf dem ich jeweils um Mitternacht durch den Kamin hinaus fahre.“
In gerader Richtung unterhalb von Silvias Standplatz wuchs eine Kopfweide. Diese Bäume gedeihen meist an Bachufern. Offenbar war an Silvias Zauber doch etwas dran. Ich war aber sehr skeptisch.
„Und wie tief unten fließt das Wasser denn?“
„Das kann ich dir nicht sagen. Da mußt du schon selbst nachsehen.“
Wir gingen den Wasseradern entlang bergauf bis zum höchsten Punkt meines Grundstücks. Ich schlug Silvia den Weg mit der Falce frei. Hier oben, im Kastanienwald, mußte ich graben. Das Gefälle gab dann genügend Druck für meine Wasserleitung.
Wir markierten jeden Wasserstrang mit einem Haselast.
„Du mußt quer zum Hang von der ersten bis zur vierten Markierung einen Graben machen und in der Mitte einen Längsgraben für den Abfluss, also ein T“, erklärte mir Silvia.
Entlang der Autostraße war mir ein anderer langer Graben aufgefallen. Guido sagte mir dann, daß die Gemeinde Sassariente, zu der auch der Monte Valdo gehört, hier eine neue Wasserleitung baue.
Es schien mir einfacher, meine Wasserversorgung derjenigen der Gemeinde anzuschließen. Und so vergaß ich meine unterirdisch fließende Wasserader wieder.
Nun mußte ich für die Baubewilligung meine Baupläne einreichen.
Ganz einfach war es nicht
Es war leicht, einen Architekten zu finden, der alle meine Wunschträume schön aufs Papier zeichnete: Das Haus mit der Jahrzahl und der Stall sollten durch einen Korridor miteinander verbunden werden. Im Stall war Platz für eine Wohnküche und ein Badezimmer. Im Heuboden obendran sah ich vor meinem geistigen Auge bereits das schönste Schlafzimmer des Jahrhunderts. Das Wohnzimmer und ein weiteres Schlafzimmer waren im alten Hausteil. Die Leute würden sich darum reißen, mein Ferienhaus Nummer eins zu mieten!
Im untern Haus mußte ich vom Wohnzimmer zum Heuboden, der ein Schlafzimmer mit Dusche wurde, eine Innentreppe einbauen lassen. Im Kellergewölbe ergab sich eine wunderschöne Küche mit Eßzimmer, wenn ich ein Fenster aus der dicken Außenmauer brechen ließ. Das wäre das etwas kleinere Ferienhaus Nummer zwei.
Im Keller des langen Hauses war Platz für eine Waschküche, im Parterre für eine Verwalterwohnung, im Dachstock sollte meine eigene kleine Wohnung sein. Für die Stromerzeugung gab es schließlich Generatoren.
Und mitten im Weinberg mußte ein Schwimmbad entstehen!
So weit würden meine Finanzen reichen. Nachher konnte ich aus den Mietzinsen und dem Ertrag des Gartens leben.
Prachtvoll sah das alles aus.
Aber die Baubewilligung ließ auf sich warten, und ich fand keine Baufirma, die die Arbeit übernehmen wollte.
„Der weite Weg ist zu umständlich“, sagten alle.
„Man müßte von der Straße aus eine Seilbahn für den Warentransport bauen.“ Dazu brauchte man eine Schneise durch den Wald. Ich wollte aber diese unberührte Wildnis nicht verschandeln.
Es gab noch die Möglichkeit des Helikoptertransportes. Ein Helikopter, der achthundert Kilogramm Material transportierte, kostete pro Flugminute dreißig Franken. Der Flugplatz war so nahe, eigentlich direkt unter dem Monte Valdo, daß ein Hin- und Rückflug nur vier Minuten dauern würde, also einhundertzwanzig Franken kostete. Gar nicht viel. Aber man brauchte zwei Männer, die auf dem Flugplatz die Beladung besorgten, und zwei andere, die oben für das Abladen bereitstanden.
Woher nahm ich die?
Es gab nur eine Lösung: ich mußte den Umbau selbst leiten und möglichst viele Arbeiten selbst ausführen.
So weit war ich an jenem dreißigsten April. Ich beschloß damals nicht nur, mein bisheriges Leben zu ändern. Ich wußte auch, daß ich mich nochmals auf die Schulbank – und zwar auf eine harte Schulbank – setzen mußte, um gleich verschiedene Bauberufe wenigstens einigermaßen zu erlernen.
Noch am gleichen Abend schrieb ich den Kündigungsbrief für meine Geschäftsräumlichkeiten. Meinen Angestellten mußte ich meine Absichten mündlich mitteilen.
Dann schrieb ich an Marco in Froda. Marco ist Baumeister. Ich fragte ihn, ob er mich während eines halben Jahres als Volontärin beschäftigen könne. Ich würde keinen Lohn verlangen und natürlich meine Versicherung selbst bezahlen.
Die Liquidation meines Geschäftes war einfach. Jedes Stück, das wegging, rechnete ich um in Zementsäcke, in Bodenbretter, in Betonkies, in Helikopter-Flugminuten, in eine Woche Lebensunterhalt.
Marcos Antwort kam erst nach drei Wochen:
„Liebe Caterina,
Wenn es unbedingt sein muß und wenn es mich nichts kostet, dann komm. Aber einer Frau bezahle ich nichts. Du wirst sehen, die Arbeit ist viel zu schwer.
Tanti saluti, Marco“
Kathrin mit der Maurerkelle
Am Morgen des einunddreißigsten Juli gab ich die Schlüssel meines Geschäftes ab. Am ersten August um null sieben null Uhr trat ich meine Stelle bei Marco an. Der Bauplatz lag etwas oberhalb von San Michele.
Meine beiden Kollegen begrüßten mich mit hartem Händedruck. Gildo hatte rotes Kraushaar, ein kugelrundes, liebes Gesicht und eine kugelrunde Gestalt. Er schaute aus wie ein lieber Seehund und war stark wie ein Bär. Luigi war ebenfalls rothaarig, aber feingliedrig. Mit seiner Brille hätte ich in ihm eher einen Bankangestellten als einen Maurer vermutet. Aber niemand konnte flinker mit der Schaufel umgehen, schönere Mauern machen als er. Am Sonntag spielte er in der Kirche von Froda die Orgel.
Ich lernte, wie man Beton, Feinbeton, Mörtel und Abrieb mischt, wie man Waagscheit, Lot und Richtschnur braucht, theoretisch auch, wie man mit Bruchsteinen mauert. Ich fürchte aber, für letzteres habe ich nicht viel Talent. Meine Lehrmeister zeigten mir unzählige Male, wie man auf die Äderung der Steine achten muß, um sie zurechtzuhauen. Natürlich brachten sie mir auch den uralten Maurerwitz bei. Wenn ich mühsam immer und immer wieder auf denselben Stein schlug, daß die Funken sprühten, rief einer:
„Wen willst du heute in Stein meißeln, die Madonna oder den San Giovanni?“
Dafür hatte ich bald den Schwung heraus, den es braucht, um Verputz an die Wand zu befördern. Weil ich die Maurerkelle immer verlegte, gewöhnte ich mir an, sie in die Gesäßtasche zu stecken. Damit hatte ich auch meinen Übernamen: die Kathrin mit der Maurerkelle.
Die ermüdendste Arbeit war es, fertige Betonmischung zu schaufeln. Ich lernte dabei Muskeln in meinem Rücken kennen, von deren Existenz ich während einundvierzig Jahren keine Ahnung gehabt hatte.
Es machte mir Spaß, die Betonmaschine zu bedienen. Mir zu Ehren tauften sie die Maschine „Caterina die Zweite“.
Ein Lastwagen brachte pro Mal vier Kubikmeter Betonkies. Die Maschine mischte jeweils Beton für drei Schubkarrenladungen. Pro Schubkarren hatte ich zwei Schaufeln Zement hinzuzufügen. Ein Sack Zement enthält zwölf Schaufeln voll.
Bang fragte ich mich, wie ich auf dem Monte Valdo die Betonunterlage für daß Schwimmbad erstellen würde. Ich bekam auch Unterricht, wie man einen Sack Zement trägt. Man muß ihn liebevoll über die Schulter legen, etwa wie ein halbjähriges Kindlein. Nur daß halbjährige Kindlein nicht fünfzig Kilogramm schwer sind. Nach einem Gang über schwankende Bretter in die Baubaracke gab ich dieses Experiment auf.
„Tu das lieber nicht mehr“, sagte Gildo, „davon wirst du zu schnell alt.“
Neues Monte-Valdo-Problem: Ich brauchte jemanden, der einen Sack Zement tragen konnte. Was nützte mein schönes theoretisches Wissen, wenn mir die nötige Muskelkraft fehlte?
Am Ende meines zweiten Volontärmonats überreichte mir Marco einen Briefumschlag.
„Dein Lohn“, sagte er trocken. „Schlechten Handlangern zahle ich sechs Franken pro Stunde, guten acht. Hier drin sind acht Franken für jede Stunde deiner Arbeit. Ich bin sehr zufrieden mit dir.“
Ich war gerührt und ganz unbändig stolz. Zur Feier des Tages lud ich Gildo und Luigi zu einem Trunk ein. Seltsam, welch kleine Ursachen große Wirkungen haben können. Denn in der Trattoria von San Michele fand ich Michelangelo.