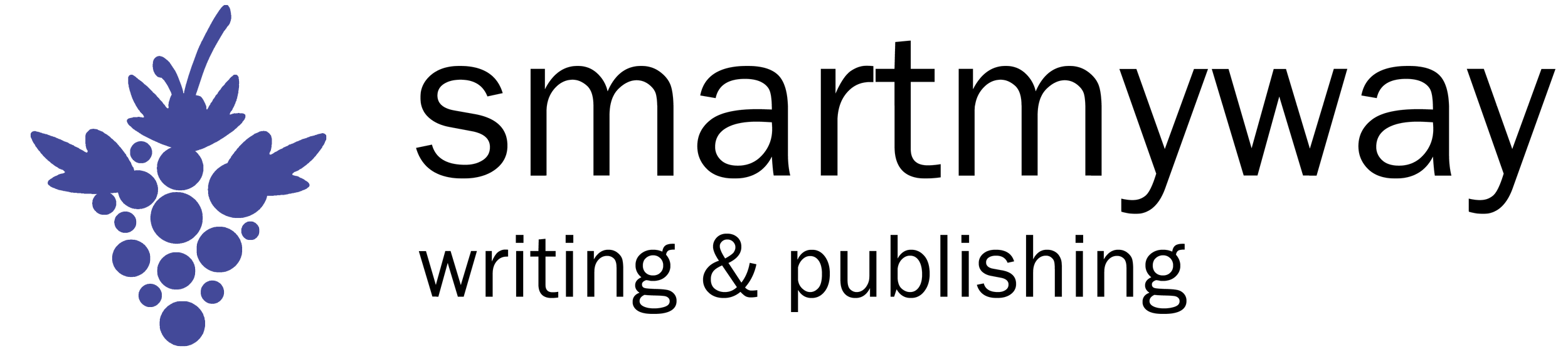Der Schweizer Souverän verdient Weitblick.

Impulse eines Beobachters zur Verbesserung der Entscheidungsfähigkeit des Souveräns und mehr Demokratie im politischen System der Schweiz am Beispiel der Zauberformel.
Die Entwicklung der Schweiz ist durch ihre Politiker bestimmt. Parlamentarierinnen und Parlamentarier bestimmen mit ihren Vorstössen, Voten und Stimmabgaben über die Ausrichtung des Landes. Sie entscheiden über die Zusammensetzung der Regierung, über Gesetze und beeinflussen die Stimmenden mit ihren öffentlichen Auftritten und Meinungen. Sie tun dies mit entscheidender Unterstützung der Medien und in einem politischen System, das im Wesentlichen die letzten 100 Jahre stabil geblieben und nicht zuletzt daher wohl ein Erfolgsgarant für die Schweiz ist. Auch hat die sich oft sprunghaft verändernde politische Agenda etwas Agiles an sich, was gut ist, weil sich damit ändernde Prioritäten auffangen lassen.
Doch ist diese inhaltliche Unsystematik im zwar systematischen Ablauf einer zunehmenden Unwucht unterworfen. Sie äussert sich in einer wachsenden Entfremdung von Souverän und Politik. Sie wird möglicherweise je länger, je mehr der grosse Schwachpunkt im Schweizer Rechtsstaat. Bundesbern ist durch den 4-Jahreszyklus der eidgenössischen Wahlen getaktet. Seine wegweisenden Inhalte bleiben aber undefiniert, langfristig werden sie erst indirekt durch die Programme der Parteien oder Vorstösse, Referenden und Initiativen beeinflusst. Ein inhaltliches Gesamtbild stellt möglicherweise die Verfassung dar – doch wer kann sie schon in allen Dimensionen erfassen, wiedergeben und erklären?
Dabei ist der Schweizer Souverän, also die Stimmenden, Auftraggeber für Parlament und Regierung. Dazu benötigt er Entscheidungsfähigkeit, die er durch Information und Involvierung erlangt. Dies ist entscheidend in der direkten Demokratie. Aufgabe von Politik, Regierung und Behörden ist es, diese beiden Faktoren sicherzustellen. Doch das Bild im Kopf ist ein anderes: Der Souverän als Stier, der von den Staatsorganen am Nasenring herumgeführt wird. Oder moderner: Der Souverän ist Produzent der Netflix-Serie “Politik Schweiz”. Doch nur mit beschränktem Mitspracherecht: Ja, er darf beim Cast mitentscheiden, manchmal auch über einen Drehort oder die Ausstattung einer Episode. Doch den Gesamtplot, das Drehbuch, bestimmt die Politik so lange wie möglich im Alleingang.
Die Zukunftsthese ist: Der Souverän muss zusätzlich strategisch Einfluss nehmen und nicht bloss über einzelne Sachfragen entscheiden, sondern themenübergreifend rahmengebend wirken können, damit in der heutigen Zeit disruptiver Veränderungen die mannigfaltigen Herausforderungen einer hochzivilisierten westlichen Gesellschaft noch bewältigt werden können. Dies gilt besonders in der schweizerischen direkten Demokratie. Daraus folgt, dass den wegweisenden Inhalten und der Involvierung des Souveräns entscheidend mehr Priorität eingeräumt werden muss. Beispielsweise mittels Verabschiedung einer 4-Jahresstrategie durch den Souverän. Dies ergänzend zur 4-jährlichen Bestellung des Personals der Schweizer Bundespolitik und dort rahmengebend für die Arbeit in Bundesbern.
Oder etwas pointierter: Wieso glauben 246 Parlamentarierinnen und Parlamentarier in Bern, die politischen Fragen und die Geschicke des Landes inhaltlich besser beurteilen zu können als die über 5.5 Millionen Stimmberechtigten?
Der folgende Essay gibt dazu Denkanstösse.
Roland Voser, 2. Dezember 2023
Die Schweizer Politserie hat für eine direkte Demokratie mit 50% eine zu tiefe Einschaltquote.
Die Nation reibt sich die Augen.
Es ist Sonntagabend, die Wahlen 2023 sind entschieden. Politik und Medien interpretieren die neuesten Wahlresultate. Die Nation denkt: Aha, die Grünen haben die Wahlen verloren und die SVP massiv gewonnen: Ja, ein Rechtsrutsch war ja nach den Klimawahlen 2019 vorauszusehen. Alle hatten erwartet, dass am Sonntagabend alles entschieden wäre und darauf seinen gewohnten Weg gehen würde.
Doch am Tag darauf reibt sich das Publikum die Augen - es folgt die Korrektur vom Bundesamt für Statistik, das einen Fehler einräumt: Die SVP hat also doch nicht so dramatisch zugewonnen. Doch entscheidender, weil zauberformelrelevant: Die FDP bleibt haarscharf mit 0.2% Wähleranteil vor der Mitte auf dem 3. Platz und hat weiterhin formelgetreu Anrecht auf zwei Bundesräte.
Die Strippenzieher der Macht werden aktiv.
Die Mitte hat sich zu früh gefreut und bleibt somit äusserst knapp bei ihrem einzigen Bundesratssitz. Vielleicht.
Denn bereits kandidiert sie nicht mehr für den Bundeskanzler (ihre Kompensation für den bisher fehlenden 2. Bundesratssitz) und ihr Parteichef Gerhard Pfister schiebt sich selbst unter dem Radar in die Poolposition, unterstützt von Stimmen, die FDP-Bundesrat Ignazio Cassis abgewählt sehen möchten. Dies, obwohl der Parteipräsident der Mitte mantramässig von sich gibt, keine amtierenden Bundesräte abzuwählen. Doch über die Jahre hat er sein konservatives Profil mitte- und damit wahlfähiger gemacht. Bundesrat als Krönung einer jahrelang darauf hingearbeiteten politischen Karriere ist die Intension.
Beim zweiten Wahlgang der Ständeratswahlen wird klar, dass die SP die geheime Gewinnerin dieser Wahlen ist und die Grünen regelrecht ins mentale Loch fallen. Der Verdacht kommt auf, dass die listige SP - gesteuert von unbeschwerten Jusos ohne grossen Konventionszwang - die naiven Grünen seit Jahren zu ihrem Zweck des Machterhalts instrumentalisiert hat (mehr dazu im Artikel zu Lisa Mazzone). Den Grünen würde jedenfalls Emanzipation und Professionalisierung gut tun.
Die nächste Episode ist die Bundesratswahl.
Dennoch stellt die Grüne Partei der Schweiz (GPS) mit Gerhard Andrey einen Sprengkandidaten für die anstehenden Bundesratswahlen auf und will damit ebenfalls den oben erwähnten Sitz der FDP übernehmen.
Doch vielleicht geht diese Rechnung nicht auf, weil die SP mit dem Basler Regierungspräsidenten Beat Jans gleichzeitig einen fundamental politisierenden Ökobauern als Ersatz für Alain Berset ins Rennen schickt und damit das Ansinnen der Grünen vereiteln könnte, denn daraus ergäben sich zwei Grüne im Bundesrat, was aktuell unrealistisch ist. Oder der Termin zum Tee von Gerhard Andrey mit den SVP-Chefs Marco Chiesa und Thomas Aeschi hat eine andere Bedeutung: Möglicherweise unterstützt die SVP den Grünen anstelle der beiden Roten. Vielleicht fühlt sich die SVP zukünftig auch näher mit Gerhard Pfister verbunden, als mit dem unglücklich agierenden Ignazio Cassis und bringt dies bei der Bundesratswahl unerwartet zum Ausdruck.
Doch warten wir ab und schauen wir als Aussenstehende dem Staffelende der Wahlen 2023 am besagten Mittwoch, dem 13.12.2023, zu. Unten im Text mehr dazu und zur Zauberformel im Speziellen.
Die Schweizer Politik erinnert an eine mittelmässige Netflix-Serie mit bescheidenem Unterhaltungswert.
Solche Ereignisse sind selten zueinander stringent. Doch passen die Schlaglichter gut ins Kurzzeitgedächtnis von Tagespresse und Lesern. Insbesondere ist das ganze Wahlprozedere für Aussenstehende oft schwer zu durchschauen.
Das mediale Heraufkochen punktueller Ereignisse macht es nicht einfacher. Selbst Volksabstimmungen zu Sachgeschäften sind anspruchsvoll. Wie soll jemand diese Komplexität verstehen, wenn schon die Parlamentarierinnen und Parlamentarier damit überfordert sind (siehe Energiepolitik).
Wie soll der Souverän anhand dieser dürftigen Informationsgrundlage entscheiden können, wenn doch der Gesamtkontext fehlt? Wie soll der Entscheid zur richtigen Requisite gefällt werden, wenn weder Plot noch Cast bekannt sind? Wieso sorgen Regierung und Politik nicht dafür, dass der Souverän mehr in die Rolle des Drehbuchschreibers kommt und adäquat mitwirken könnte?
Wieso wähnt sich der Souverän bei jedem politischen Ereignis wie in einer Netflix-Episode mit ihrem Cliffhanger? Dieses Gefühl wird bei der Bundesratswahl verstärkt: Der Souverän ist in die Statistenrolle versetzt.
Das Volk ist bloss Publikum, bestenfalls Produzent ohne durchgängiges Mitspracherecht.
Es macht den Anschein, dass die Politik den Souverän in der Rolle des unbeteiligten Produzenten halten möchten. Die “künstlerische” Freiheit der Schweizer Politserie soll vollkommen bei ihr bleiben. Etwa so wie bei einer repräsentativen Demokratie, wie es Deutschland eine ist.
Irgendwann wenden sich viele Bürgerinnen und Bürger von dieser Veranstaltung ab, die jeweils mit den Bundesratswahlen ihren weiteren Höhepunkt erreicht. Das Parlament wird in solchen Tagen nahezu ekstatisch. Das ist zugegebenermassen nachvollziehbar, denn die Gewählten zelebrieren sich selbst, trinken einen Schluck aus dem Kelch der Macht und bilden als vom Volk gewählte Elite nun also dessen Regierung.
Der Souverän betrachtet das Schauspiel je länger je ernüchterter. Teile wenden sich ab und über die Jahre ergibt sich eine Stimmbeteiligung von 50%, wie auch bei den diesjährigen Wahlen 2023.
Die Zauberformel bestimmt die Schweizer Regierung und ist doch etwas selten Undemokratisches.
Seit 1959 im Einsatz.
Es lohnt sich ein näherer Blick auf die Bundesratswahl. Erstaunlich, diese Zauberformel. Sie ist bloss ein Agreement im Parlament, nachdem die Bundesratsposten besetzt werden sollen. Sie stellt keine verbindliche Vorgabe oder ein festgeschriebenes Gesetz dar.
Doch wird sie oft beschworen und viel Aufhebens um sie gemacht. Offensichtlich steht im Parlament bei der Bundesratswahl die Machtpolitik im Zentrum. Die Zauberformel hilft bei deren Machterhaltung.
Dies ist zwar nachvollziehbar, aber umso unverständlicher, dass hierfür der Schweizer Staat keine gesetzliche Grundlage vorsieht, die Klarheit schafft und unfaire Machtverhältnisse oder gar Willkür verhindert.
45 Personen entscheiden, wer Bundesrat wird?
Aktuell geht es dieses Jahr also um die Nachfolge von SP-Bundesrat Alain Berset. Die Wahl seiner Nachfolge fällt zusammen mit den Erneuerungswahlen des Gesamtbundesrates.
Im Vorfeld hat dazu die SP-Fraktion für die Bürgerlichen eine Auswahl von Pest und Cholera bestimmt - die Fraktion setzt einen jungen Juso mit ungenügendem Leistungsausweis und einen rot-grünen Ökobauern mit Nähe zu Verschwörungstheorien aufs Zweiticket. Die SP hat Personen vorgeschlagen, die sie gut findet. Sie müssen den Bürgerlichen nicht gefallen. Aus Sicht der SP ist also alles gut. Doch auch aus Sicht des Souveräns?
Und - dieses Mal sollen wiederum tatsächlich nur 45 Personen entscheiden, wer neuer Bundesrat und Teil der Schweizer Regierung wird, denn der Rest des Parlaments darf nur noch zwischen diesen beiden Kandidaten wählen - andernfalls drohen von Strippenziehern orchestrierte Retourkutschen. Kann der im Jahre 2007 aufgeführte Freudentanz von Hugo Fasel für erfolgreiches Strippenziehen und Intrigenspiel an Peinlichkeit noch überboten werden? Ist das Parlament ein grosser Kindergarten von Schadenfreudigen? Das Bundeshaus als Intrigantenstadel?
Demokratisch ist, wenn die Bundesversammlung ohne verbindliche Instruktionen Bundesräte wählt und damit Artikel 175 der Bundesverfassung respektiert.
Der Souverän - als Aussenstehender - nimmt diese Szenen konsterniert zur Kenntnis. Spätestens jetzt zappt die Mehrheit weg.
Die Grösse von Interlaken entscheidet über einen Bundesrat in der Schweiz.
Wenn die SVP als wählerstärkste Partei also rund 28% der Stimmen macht (siehe Abbildung 1), dann entsprechen diese bei einer Wahlbeteiligung von 50% folglich 14% von 5.5 Millionen Stimmberechtigten. So gesehen haben an der Urne also 770’000 Menschen die SVP gewählt.
Dies entspricht der Einwohnerzahl des Kantons Aargau. Der Rest der Bevölkerung hat somit anders oder nicht gewählt. Nichts gegen meinen Heimatkanton Aargau, aber sich mit dieser in diesem Kontext doch überblickbaren Grösse permanent als wählerstärkste Partei in den Vordergrund zu rücken, ist doch eher als Plattitüde zur Kenntnis als tatsächlich ernst zu nehmen.
Oder: Der Abstand von 0.2% zwischen der FDP und der Mitte entsprechen 0.1% von allen Stimmberechtigten. Das sind also 5’500 Wählende. Wer kann es hier ernsthaft in Ordnung finden, dass defacto eine Gemeinde mit der Grösse von Interlaken (mit ihren knapp 5’500 Einwohnern) darüber entscheidet, dass gemäss der ominösen, im Jahre 1959 eingeführten Zauberformel, die FDP (als drittstärkste Partei) zwei Bundesräte und die Mitte (als viertstärkste Partei) nur einen Bundesrat stellen darf?
Die Zauberformel hat mit Demokratie nichts zu tun.
Irgendwann verschwindet der Zauber. Irgendwann funktioniert er nicht mehr, weil sich das Umfeld weiterentwickelt. Irgendwann übernimmt die neue Generation. Die Bewahrer gehen von dannen und die Neuen entscheiden, ob der Bestand weiter bestehen oder eben erneuert werden soll. So geht es irgendwann auch mit der Zauberformel.
Die Hypothese ist: Die Zauberformel hat ausgedient, weil sich die politischen Themen und damit auch die Parteien zu stark verändert haben, als dass sie sinnvoll fortgeführt werden könnte. Die Zauberformel ist in der vorliegenden Diskussion als Beispiel von politischen, formellen Ritualen zu verstehen, die eigentlich fragwürdig und letztlich zu verändern sind.
1959 waren 4 relevante Parteien im Geschäft: 3 Grosse und eine Kleinere (siehe Abbildung 3). Daher passte die Zauberformel damals sehr gut. Die 3 grossen Parteien bekamen je 2 Bundesräte und die kleine einen (und mit dem Bundeskanzler einen Halben dazu). Heute ist es eine grosse Partei und 4 Kleinere (wenn man GPS und GLP einfachheitshalber als eine Grüne Partei rechnet). Heute passt die Zauberformel nicht mehr, weil heute eben faktisch das erwähnte Interlaken über einen Bundesrat entscheidet - was gegenüber dem Souverän undemokratisch ist.
Die Zauberformel hat undemokratisch Machtverhältnisse zementiert und verhindert Erneuerung.
Man muss letztlich eingestehen: Die Zauberformel ist ein sehr undemokratisches Verfahren und der Schweiz unwürdig. Doch hat sie über die Jahrzehnte für Kontinuität und Stabilität in der Regierung gesorgt. Andererseits hat sie bestehende Machtverhältnisse auf Jahre zementiert. Was nachweisbar für Innovation und Erneuerung nachteilig ist.
Offenbar scheint diese Zauberformel dem Parlament zu gefallen, denn es kann so nach eigenem Gefallen Personen in den Bundesrat schieben, die nicht die Besten sein müssen. Vielmehr sollen sie durch die jeweilige Partei kontrollier- und steuerbar bleiben. Auf der anderen Seite wählen die Parlamentarier von der Gegenpartei möglichst schwache Kandidierende, damit die portierende Partei keinen Erfolg verbuchen und ein willkommener Sündenbock für die kommende Legislatur bereits mit dessen Wahl gefunden ist. Dies ist unfair gegenüber jenen, die sich für das schwierige Amt des Bundesrates zur Verfügung stellen.
Wenn Parteien zu Staatsfeinden werden.
Damit hieven Parten bewusst unfähige Personen in den Bundesrat. Bei allem Respekt zur vereinigten Bundesversammlung: Das ist verantwortungslos und schlicht staatsfeindlich. Die SVP toppt diesen Umstand, indem sie andere Gewählte als den von ihr portierten Kandidierenden aus der Partei ausschliessen kann. Und – wieso sollen sich fähige Köpfe in einem solch verdrehten System zur Verfügung stellen, das offenbar auf Intrigen, Sündenböcken und Ferngesteuerten basiert? Die Frage ist, ob aufgrund der wenigen Vorteile der Zauberformel wirklich die Demokratie ausgehebelt werden darf und ob es tatsächlich kein anderes demokratisches Verfahren gäbe, dass diese Vorteile ebenfalls bieten würde.
Damit noch nicht genug: Hätten sich nämlich GPS und GLP nicht aufgespalten, kämen diese beiden Parteien gemeinsam (im Folgenden als Grüne bezeichnet) heute klar auf den 3. Platz (Planspiel 1, siehe Abbildung 1). Die FDP hätte dann nach heutiger Lesart noch 1 Bundesrat zugute, die Mitte keinen mehr.
Würden sich SP und GPS zusammenraufen, dann hätten diese beiden Parteien miteinander 2 Bundesräte, was aus ihrer Sicht keine Verbesserung bringt. Kleine Anekdote am Rande: Mit der Nominierung des oben erwähnten Ökobauern hat die SP möglicherweise unbewusst diese Entwicklung bereits vorweggenommen und den ersten “grünen” Bundesrat portiert. Auf der anderen Seite hätte die FDP mit oder ohne GLP 2 Bundesräte und die Mitte noch einen Bundesrat (Planspiel 2, siehe Abbildung 1).
Würden sich drei Blöcke bilden, dann käme eine andere Aufteilung zum Einsatz: Der wählerstärkste Block bekommt 3 Bundesräte, die beiden anderen je 2 (Planspiel 3, siehe Abbildung 1). Daraus folgt, dass die Zauberformel nicht nur undemokratisch, sondern auch unzweckmässig ist. Sie ist entzaubert und basta. Ja mehr noch: Sie behindert vielmehr unnötig die Erneuerung der Schweiz und einen starken gemeinsamen Fokus auf die tatsächlich relevanten Themen wie Umweltschutz und Migration (siehe Abbildung 7).
Demokratisch wäre es vielmehr, wenn in der anstehenden Bundesratswahl die Parlamentarier frei für sich entscheiden, welche Bundesräte sie bestätigen wollen und welche Kandidierende sie neu ins Gremium wählen wollen. Eine Absprache dazu in der eigenen Partei ist normal und legitim. Es wäre eine Sofortmassnahme zur Wiederinstallation der Demokratie in der Bundesratswahl.
Abbildung 1: Die Zauberformel im Planspiel. Quelle SRF und smartmway.
Hundert Jahre Rückschau ist erhellend.
In der Vergangenheit liegt die Geburt der Zukunft.
Um das Ganze besser zu verstehen, lohnt sich ein Blick 100 Jahre zurück. Das BfS (Bundesamt für Statistik) hat dazu zuvorkommend geholfen. Die gesuchten Daten waren rasch und tadellos verfügbar. Die daraus erstellte Datenbasis gibt nun eine zweckmässige Diskussionsgrundlage mit der Mandatsverteilung im eidgenössischen Parlament von 1919 bis 2023 (siehe Abbildungen 2 und 3).
Die Langfristigkeit eines Unternehmens wird durch seine Strategie bestimmt. Im Schweizer Rechtsstaat ist dafür das Parlament zuständig. Es ist die Legislative, die gesetzgebende Gewalt im Staat. Es kennt zwar (noch) keine Strategie, sondern wirkt vielmehr mit einzelnen Gesetzen punktuell rahmengebend und gibt damit scheibchenweise sowohl Richtung wie auch Leitplanken der Regierungsarbeit des Bundesrates vor.
Die Menschen auf den Parlamentssitzen entscheiden.
Es macht also Sinn, für die Frage der langfristigen Ausrichtung der Schweiz das Parlament und dessen Sitzverteilung in Ständerat und Nationalrat zu betrachten. Denn die Volksvertreterinnen und Volksvertreter dieser beiden Kammern werden alle 4 Jahre gewählt und sind im Anschluss mit ihrem individuellen Einfluss für die Ausrichtung der Landespolitik gesetzgebend mit Vierjahreshorizont zuständig.
Wähleranteile geben zwar Aufschluss über die Legitimation einer Partei, doch bleiben die Sitze entscheidend, denn diese geben konkreten Geschäften jeweils ihre Stimme und entscheiden so tatsächlich.
1919 kam im Nationalrat erstmals das Proporzwahlrecht zur Anwendung, mit dem Minderheiten besser berücksichtigt wurden und damit ihre Anliegen ins politische Leben einbringen konnten. Diese Wahlen begünstigten damals die beiden heutigen Polparteien SP und SVP (die ehemalige Bauernpartei). Daher macht dieser Betrachtungszeitraum umso mehr Sinn.
Abbildung 2: Zeitreihe der Sitzverteilung im Ständerat über die letzten 100 Jahre. SVP: SVP/Lega/SD/Rep./EDU/FPS/MCR | FDP: FDP/LPS | Mitte: Mitte/CVP/BDP/LdU/EVP | Grüne: GPS/GLP/FGA | SP: SP/Dem./CSP/PdA/PSA/POCH/Sol. Quelle BfS Ständerat.
Proporzwahlrecht im Nationalrat, Majorzwahlrecht im Ständerat und das Zweikammersystem.
Die bisher unangefochten staatstragende FDP verlor bei dieser Umstellung nahezu die Hälfte ihrer Sitze und damit ihre klare Vormachtstellung im Bundesstaat seit dessen Gründung im Jahre 1848.
Die andere Kammer, der Ständerat mit je 2 Vertretern pro Kanton, wird mit wenigen Ausnahmen im Majorzwahlrecht in einer Volkswahl bestimmt. Hier entscheiden also Mehrheiten. Konkret entscheidet die Mehrheit über einzelne Personen für die beiden Ständeratssitze. Der Ständerat ist also eine Personenwahl.
Beim Nationalrat bestimmt der Souverän primär die Anzahl Sitze einer Partei auf denen die von dieser Partei Gewählten Platz nehmen können. Der Nationalrat ist also im Kern eine eigentliche Parteienwahl (Listen) mit Hilfe ihrer Kandidierenden (Listenplätze).
Hier macht sich eine weitere wesentliche Eigenheit des Schweizer Zweikammersystems bemerkbar. Das politische System der Schweiz fusst auf der Einigkeit beider Räte. Das heisst, dass sowohl Ständerat als auch Nationalrat einem Gesetz zustimmen müssen, bevor es in Kraft treten kann. Die bedeutet, dass eine grosse Vertretung im Nationalrat nicht zwingend Entscheide herbeiführen kann, wenn der Ständerat nicht mitmacht.
Es bedeutet auch, dass Ständeräte bei den Wählern ein parteiübergreifendes Vertrauen geniessen (müssen), das bei Nationalräten, wie erklärt, deutlich weniger ausgeprägt ist.
Abbildung 3: Zeitreihe der Sitzverteilung im Nationalrat über die letzten 100 Jahre. SVP: SVP/Lega/SD/Rep./EDU/FPS/MCR | FDP: FDP/LPS | Mitte: Mitte/CVP/BDP/LdU/EVP | Grüne: GPS/GLP/FGA | SP: SP/Dem./CSP/PdA/PSA/POCH/Sol. Quelle BfS Nationalrat.
5 Parteien im Fokus: SVP, FDP, Mitte, Grüne, SP.
Über die Jahre hat sich die Parteienlandschaft verändert. Auch haben Parteien ihre Inhalte weiterentwickelt und neu gestaltet.
Aus Übersichtlichkeitsgründen ist die folgende Abhandlung auf 5 Parteien zusammengefasst: SVP, FDP, Mitte, Grüne (mit GPS und GLP), SP sind somit die heute relevanten Protagonisten. Kleinere Parteien sind ihnen nach möglichst übereinstimmenden Inhalten oder der Fraktionszugehörigkeit zugeordnet (siehe Abbildungen 2 und 3).
Auffallend dabei der Unterschied der Parteien-Vertretungen in Ständerat und Nationalrat: Im Ständerat dominieren Parteien (Mitte und FDP), die gemäss Wähleranteilen deutlich weniger Bedeutung haben. Die Ursache liegt im erwähnten Majorzwahlrecht im Ständerat.
Es signalisiert, dass der Souverän - also die wahlberechtigte Bevölkerung - Personen dieser eher ausgleichenden Parteien den Vorzug geben. Diese Persönlichkeiten werden in der Regel als vertrauenswürdiger beurteilt als die Kandidierenden der anderen Parteien (SVP, Grüne, SP),
Das politische Umfeld hat sich seit 1959 verändert. Die Strukturen blieben unverändert.
Zwei Meilensteine für die Veränderung der Politlandschaft.
Die politische Erneuerung der Schweiz wurde bereits vor Jahren durch zwei wesentliche Ereignisse eingeleitet (siehe Abbildung 4):
Einerseits im Jahre 1979 mit dem Einzug der Grünen Partei ins eidgenössische Parlament und
1992 mit der Ablehnung des EWR (Europäischer Wirtschaftsraum) und der daraus neu formierten SVP, die heute mit rund einem Drittel der Wählerstimmen stärkste Partei der Schweiz ist.
Heute, Jahrzehnte später, sind die Kernthemen der beiden Parteien - Nachhaltigkeit und Migration - selbst im globalen Umfeld relevante Themen (siehe Abbildung 7).
Abbildung 4: Die Veränderung vom Parteispekturm zwischen 1919 und 2023. Quelle: smartmyway.
Es sind diese beiden Ereignisse, die die schweizerische Politik der letzten Jahrzehnte massgeblich beeinflusst und geprägt haben. Doch hat damit auch eine Erneuerung im politischen System stattgefunden? Wie werden weiter folgende Einflüsse berücksichtigt:
Die Bevölkerung wuchs seit den 60-iger Jahren von 6 Millionen auf nun bald 9 Millionen an.
Die Digitalisierung hat in vielen Lebensbereichen zeitliche, inhaltliche und selbst geographische Quantensprünge verursacht. Die technologische Entwicklung führt in Zukunft zu tektonischen Verschiebungen in der Gesellschaft.
Es sind fremde Kulturen aus anderen Kulturkreisen im Land ansässig geworden.
Die Schweiz glaubt, mit einem unveränderten System aus der Zeit der beiden Weltkriege die Herausforderungen der Zukunft meistern zu können? Ja, die politische Entwicklung ist tatsächlich in den Teenagerjahren der Boomer-Generation stehen geblieben. Seit der Gründung des Kantons Jura im Jahre 1978 hat sich in Bundesbern nichts mehr Wesentliches strukturell geändert. Die Schweiz wurde von Regierung, Politik und Beamten in unveränderter Manier weiter verwaltet, die inhaltlichen Werte manchmal etwas zurechtgebogen, aber mehr eigentlich nicht. So ist auch die parteipolitische Zusammensetzung des Bundesrates nach der Zauberformel noch heute im Einsatz.
Drei Pole gibt es nicht, ein Parteispekturm ist ein zweckmässigeres Bild.
So weit so gut. Die Frage stellt sich, ob mit der Zauberformel auch ihre Bestimmenden, die Parteien, an ihr Ablaufdatum gelangt sind. Das Bild der Pole ist für die Schweiz nicht zweckmässig, denn es impliziert ein politisches System mit einer Regierung und einer Opposition und damit der Extreme.
Dies ist in der Schweiz nicht der Fall, solange mit den 7 Bundesräten alle relevanten Parteien in der Regierung eingebunden sein sollen. Daraus entsteht eine Konsenspolitik und damit ein stabiler Rechtsstaat, der Sicherheit und damit ein starkes Fundament für seine Menschen und Unternehmen bildet.
Der Erfolg der Schweiz gibt diesem Konzept der Einbindung recht. Daran soll nicht gerüttelt werden. Also ist als Orientierungshilfe ein einfaches und griffiges Spektrum hilfreicher. Es geht dabei nicht um “gute” und “schlechte” Parteien, sondern, wofür sie stehen. Ein mögliches Spektrum wäre dreigeteilt:
Eine Rechtspartei würde demnach für Freiheit und Selbstverantwortung stehen,
eine Linkspartei im Gegensatz dazu für Gemeinwohl und Nachhaltigkeit
eine Mittepartei sucht die Balance und Kombination beider Aspekte.
Die Statistik sagt, dass jeweils in der Mitte die meisten sind. Die gesellschaftliche Mitte müsste rein statistisch begründet die grösste Vertretung haben: Die sogenannte Normalverteilung weist dieser Mitte rund zwei Drittel der Menschen zu (siehe Abbildung 5). Daraus ergibt sich, dass sich die meisten Menschen eine Balance und Kombination rechter und linker politischer Aspekte wünschen. Es würde von einem starken Grundbedürfnis nach Harmonie zeugen.
Abbildung 5: Normalverteilung am Beispiel des IQs - Die Darstellung zeigt die Verteilung des Intelligenzquotienten einer grossen Stichprobe. Daraus wird ersichtlich, dass rund zwei Drittel der Gesamtbevölkerung in den mittleren Normbereich zwischen 85 und 115 fallen. Das restliche Drittel erzielt entweder viel höhere oder viel tiefere Werte. Quelle: Spektrum der Wissenschaft.
Die Gesellschaft bzw. der Schweizer Souverän ist also in dieser statistischen Betrachtung abbildbar. Was würde dagegensprechen? Nichts, denn es ist nicht die Mehrheit, die viel Lärm um ihre Anliegen macht. Der überwiegende Anteil der Bevölkerung sind Menschen, die ihre Sache gut machen wollen und in Ruhe leben möchten.
Würde sich die Mehrheit so aufführen wie ungezogene Klimakleber, kleinere und grössere Kriminelle oder gewaltbereite Demonstranten, dann wäre die Schweiz längst im Chaos versunken. Das ist sie aber nicht. Oft bleibt trotzdem der mediale Fokus bei den schrägen Vögeln hängen, selbst wenn verantwortungsvolle und konstruktive Exemplare die Ausnahme sind.
Die Schweizer Konsenspolitik führt statistisch zur Mitte-Lastigkeit, zu Kompromissen mit einer guten Lösung.
Wenn nun eine Rechtspartei 30% Wähleranteil ausmachen würde, dann bewegen sich entsprechend der Normalverteilung also automatisch rund 15% ihrer Wählenden im Mitteblock. Dasselbe gilt für eine Linkspartei. Andererseits vertritt eine Mittepartei mit 30% eben nur die Hälfte der tatsächlich in der “Mitte” denkenden Menschen.
Wendet man nun die Normalverteilung auf das politische System der Schweiz an, hat diese also ein “Mitte-lastiges” Parteienspektrum. Das heisst, dass sich die Wählenden der Parteien eigentlich sehr ähnlich sind: Letztlich wünschen sie sich einen Kompromiss mit einer ausbalancierten Lösung, die die relevanten Aspekte vorteilhaft kombiniert. Niemand will Konflikte.
Abbildung 6: Positionierungsspektrum mit den Schweizer Parteien angelehnt an die Sitzverteilung im Nationalrat nach den Wahlen 2023. Die Wählenden positionieren alle Parteien zu einem grossen Teil in der Mitte. Quelle: smartmyway.
Um die Grünen als Veränderungstrigger zu verstehen, reichen die Wahlresultate 2023 nicht.
Damit die Veränderung über die hundert Jahre augenfällig wird, verbinden wir Start- und Endposition der Zeit zwischen 1919 und 2023 (siehe Abbildung 4). Die Verbindung der Sitzverteilung von 2019 im Vergleich zu 2023 zeigt, dass bis auf die Rechtspartei die anderen ursprünglichen Parteien zu Gunsten der Vielfalt verloren haben. Mit dem Eintritt der Grünen anlässlich der Wahlen 1979 beginnt sich die Parteienlandschaft zu verändern.
Das beiliegende Bild “Vergleich 2019 und 2023” könnte wie folgt interpretiert werden (siehe Abbildung 4):
Die Hälfte der grünen Wähler dürften von der SP stammen. Der Rest wohl von der Mitte und der FDP.
Die SVP hat ihren Wähleranteil wohl massgeblich zu Lasten der FDP verdoppelt, damit wird selbst die SVP “Mitte-lastig”. Interessant ist, dass seit 1919 die Vertretung im Nationalrat von SVP und FDP in etwa stabil bei 50% liegt.
Heute sind die Inhalte in der politischen Arbeit verteilt. Dennoch gibt es klare Themenschwerpunkte über alle Parteien.
Parteiprogramme sind gerade nicht hilfreich. smartvote umso mehr.
Die Parteien haben ihre Inhalte in ihren Programmen, Agenden und/oder Themen festgehalten (SVP, FDP, die Mitte, GPS, GLP, SP).
Auf eine weitere Analyse dieser Programme wird verzichtet, weil sich die Parteien zu viele Themen auf die Fahne geschrieben haben und sich in zu vielen Details verlieren. Dieser Umfang ist für niemanden in vernünftiger Art und Weise aufnehmbar. Schon gar nicht für Aussenstehende. Weniger wäre hier mehr.
Also ist eine andere Quelle für die Inhaltsbestimmung erforderlich. Die Auswertung auf der Grundlage der smartvote-Erhebungen für die einzelnen Parteien sind hierzu hilfreich und ergeben für die entsprechenden Themenbereiche ein aufschlussreiches Bild (siehe Abbildung 7):
Die primären Veränderungsthemen sind Umweltschutz und Migrationspolitik. Kontrovers werden die Themen jeweils ganz links und ganz rechts im Spektrum gesehen. Hier besteht der klassische Konflikt zwischen Bewahren und Verändern. Menschen sehen bei Veränderungen ihren Besitzstand gefährdet. Die heutigen Gewinner sehen sich als zukünftige Verlierer, die heutigen Verlierer als zukünftige Gewinner. Veränderer sehen in der Veränderung die Chance auf neuen Besitzstand.
Der Sozialstaat wird von keiner Partei in Frage gestellt. Er soll zumindest optimiert, aber auch nicht disruptiv verändert werden. Die gute Botschaft ist: Offensichtlich ist er die anerkannte Grundlage aller relevanten politischen Kräfte.
Bei der Aussenpolitik gibt es die einzige Spaltung in der Parteienlandschaft: Die SVP gegen alle anderen Parteien. Die Erklärung liegt in der im Jahre 1992 von der SVP quasi im Alleingang gewonnenen EWR-Abstimmung: Dieser Erfolg hat die DNA der Partei neu programmiert und sie damit auch darin gefangen.
Mehr oder weniger Konsens besteht in einer offenen Gesellschaft und einer sparsamen Ausgabepolitik. Beide Punkte sind wichtig, denn sie stellen die stabile Grundlage für einen verantwortungsvollen Rechtsstaat dar.
Liberale Wirtschaftspolitik und Law & Order sind dort ausgeprägt, wo Eigeninitiative im Vordergrund steht: Unternehmertum benötigt eine klare Rahmengebung und darin möglichst hindernisfreie Entfaltungsmöglichkeiten.
Abbildung 7: Gewichtung der Themenbereich aus Sicht der Kandidierenden für das eidgenössische Parlament in den Wahlen 2023. SVP | FDP | Mitte | Grüne: GPS/GLP | SP. Quelle SRF.
Parteien sind Interessenvertreter von Gruppen und/oder Anliegen.
Ursprünglich waren Parteien dafür gedacht, Vorteile für ihre Wählenden zu schaffen. Dies bedeutet also eine Interessensteuerung. Parteien waren dafür gedacht: Sie sollten Interessen einer Gruppe vertreten. Die Bauernpartei vertrat die Interessen der Bauern. Doch wen vertritt heute die Nachfolgepartei SVP? Oder die SP? Die SVP hat früher die Bauern vertreten. Die SP die Arbeiterschaft. Die FDP die Unternehmer. Wir wissen es nicht, denn die Parteien sind indifferent geworden. Sie vertreten opportunistisch jene Wählenden, die der Partei Gewinne und Wachstum versprechen und bewirtschaften die dazu hilfreichen Themen.
Mit der Grünen Partei wird beispielsweise das grüne Anliegen Umweltschutz vertreten. Doch vertritt die grüne Partei demnach nun die Umweltschützer? Und im Umkehrschluss, sind damit alle Umweltschützer gleich links? Kann die Grüne Partei in anderen Themenbereichen etwas beitragen, wenn diese für sie gemäss Definition im Kern unwichtig sind, weil sie jeweils nur den Nachhaltigkeitsaspekt einbringt und damit nicht das Ganze im Auge hat?
Ein anderes Beispiel war die CVP, die Christlichdemokratische Volkspartei, die “christlich” in ihrem Namen trug. Teilte sie damit mit, dass alle anderen nicht christlich sind? Oder zumindest nicht genügend gute Christen, als dass sie nach christlichen Grundwerten Politik machen könnten? Oder analog: Können nur die Grünen gute Grüne sein?
Abbildung 8: Matrix Interessenvertretung: Die Grüne Partei vertrat ursprünglich primär das grüne Anliegen Umweltschutz und reklamiert damit das Thema für sich. Quelle: smartmyway.
Die Parteien sollten sich zuerst klarmachen, wen sie vertreten vertreten wollen und dies mitteilen.
Nochmals die Frage nach der Vertretung. Wen vertreten eigentlich die heutigen Schweizer Parteien? Aussenstehende müssten aufgrund der Namensgebung wohl wie folgt Annahmen treffen:
Die SVP (Schweizerische Volkspartei) vertritt das Schweizer Volk?
Die FDP (Freisinnig-Demokratische Partei) vertritt Demokraten, die frei sein wollen?
Die Mitte vertritt Menschen, die sich nicht entscheiden können oder in der Mitte zwischen zwei nicht näher bezeichneten Dingen stehen?
Die Grüne Partei vertritt grüne Menschen, aber nicht andersfarbige?
Die SP (Sozial-Demokratische Partei) vertritt demokratische Sozialisten?
Soll jeder für sich selbst diese Fragen beantworten. Ist es für die Wählenden aufgrund dieser möglicherweise realistischen minimalen Informationsgrundlage nicht bloss ein Glücksfall, wenn sie die richtige Partei erwischen? Nimmt in diesen Fällen die gewählte Partei tatsächlich Partei für ihre Interessen und Anliegen? Diese Vermischung der Interessenvertretung von Gruppen und/oder Anliegen durch Parteien macht die Sache nicht einfacher. Die Matrix Interessenvertretung (siehe Abbildung 8) hilft beim Schärfen eines Parteiprofils: Wenn ein Themenbereich für die Schweiz relevant ist, muss eine Partei eine klare und begründete Haltung dazu haben.
Fazit.
Die Ausführungen sind nicht vollständig. Wie gesagt - es sind Gedanken eines aussenstehenden Beobachters. Doch zeigen sie aus Demokratiesicht und damit aus Sicht des Souveräns und der direkten Demokratie zweifellos Handlungsbedarf auf. Wie das mögliches Zielbild dazu aussehen soll, kann und soll hier nicht beantwortet sondern höchstens angedeutet werden. Doch scheint die Diskussion dazu überfällig, weil einige der aufgeführten Aspekte aus der politischen Gewohnheit heraus als “normal” empfunden werden, aber in Tat und Wahrheit erschreckend grotesk sind.
Das Schweizer Politsystem sollte sorgfältig erneuert werden. Instrumente wie die Zauberformel sind undemokratisch, gehören abgeschafft und durch ein faires demokratisches und legales Verfahren ersetzt. Als Sofortmassnahme sollten sich die Parlamentarier bereits am nächsten Wahlmittwoch frei fühlen in den Bundesrat zu wählen, wen sie wollen. Die Schweiz wird nicht zusammenbrechen - im Gegenteil, es wird damit ein heilsamer Erneuerungsprozess eingeleitet.
Der Souverän ist zukünftig mit geeigneten Massnahmen in die strategische Rahmengebung für eine Legislatur einzubinden. Die Eigendynamik im Parlament soll sich auf die Arbeit innerhalb dieses Rahmens beschränken und dessen Gestaltung dem Souverän überlassen. Dies ist entscheidend für Bestand und Weiterentwicklung der direkten Demokratie. Das Volk sei damit überfordert, werden einige sagen. Diese ablehnende Haltung ist bloss Entschuldigung für das Nichtstun und die bestehenden Machtverhältnisse und Privilegien zu schützen. Doch der Souverän darf nicht unterschätzt werden.
Politik und Behörden müssen dazu das nötige Informations- und Involvierungssystem für den Souverän bereitstellen und korrekt bewirtschaften. Gerade die heutige Technologie böte wirkungsvollere Mittel, als diese aus dem letzten Jahrhundert stammenden Abstimmungsbüchlein. Für eine fortschrittliche Demokratie ist diese unzureichende Form und dieser ungenügende Inhalt fragwürdig. Hier muss Bundesbern einfach mehr und besser liefern.
Die Unterscheidung von Inhalten und Verfahren ist durchgängig offenzulegen und für den Souverän klar erkennbar zu machen. Inhalt vor Form muss das Motto sein, nicht länger umgekehrt. Parlamentarische Komissionen müssten nach den für den Souverän relevanten Themen organisiert sein, nicht nach internen Strukturen. Diese Aufteilung wird dazu führen, dass signifikant mehr über Inhalte - das Entscheidende - gesprochen und debattiert wird. Administration und Bürokratie kommt erst zum Tragen, wenn die inhaltlichen Pflöcke eingeschlagen sind.
Eigentlich wissen es alle, dass es so nicht weiter geht. Oder sie verschlafen gerade die Zukunft. Es geht um nichts weniger, als eine funktionierende direkte Demokratie für bald 10 Millionen Einwohner. Eine enorme Herausforderung. Dazu benötigen wir den besten Rückhalt im Souverän, seine bestmögliche Rahmengebung und für die Umsetzung die Besten in Regierung und Parlament.
P.S.
Falls es von Interesse ist und die Parteizugehörigkeit entscheidend bleiben soll - meine Meinung für die Besetzung des Bundesrats:
SVP 2
FDP 1
Mitte 1
Grüne (GPS oder GLP) 1
SP 1
Egal welche Partei 1
Und es gilt eine Amtszeitbeschränkung auf maximal 8 Jahre.
smartmyway unterwegs.
(c) 2018: Monte Bar mit Blick in Richtung Italien zum Gran Paradiso, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Maurizio Vogrig.
Seit 2018 Chief Editor, Mitbegründer, Verwaltungsrat und Teilhaber von smartmyway, Autor, Coach, Mentor und Berater. Vorher als Geschäftsführer von Media Markt E-Commerce AG, Media Markt Basel AG, Microspot AG sowie in den Geschäftsleitungen von Interdiscount AG und NCR (Schweiz) AG tätig. Heute Digital Business Coach und Schreiberling.
Experte für Digitalisierung, Agile SW-Entwicklung, Digital-Business, Handel, Sales & Marketing, E-Commerce, Strategie, Geschäftsentwicklung, Transformationen, Turn Around, Innovation, Coaching, erneuerbare Energien, Medien, Professional Services, Category Management, Supply Chain Management