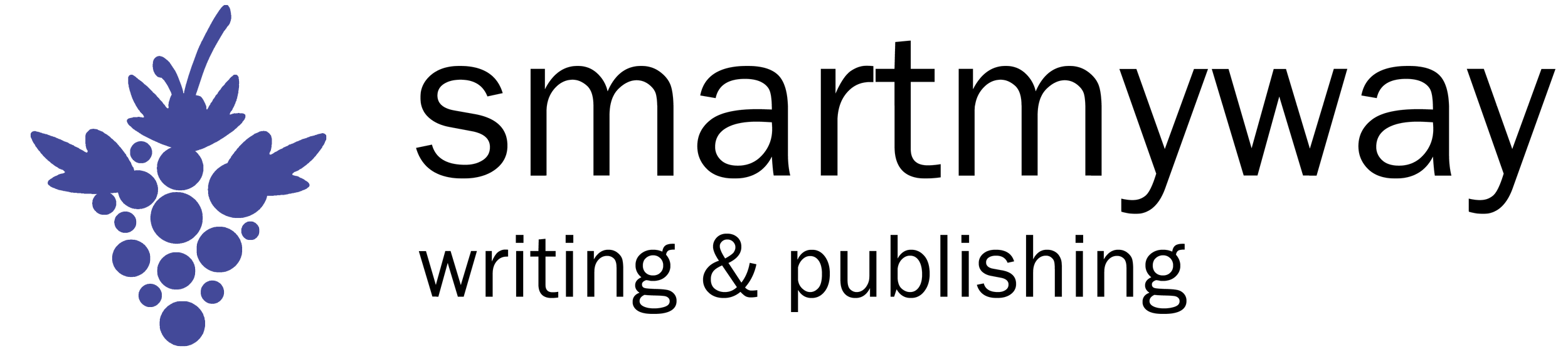Sie bezahlen, was Sie wollen.
Auf dieser Seite können Sie das Buch Kleine Welt im Tessin kostenlos lesen. In jener Schreibe, wie es die Autorin 1974 verfasst hatte. Wir veröffentlichen zum Start jede Woche ein neues Kapitel. Sie entscheiden, wie Sie die weitere Verlagsarbeit von smartmyway unterstützen möchten. Sie haben die Wahl:
Sie lesen das Buch kostenlos, freuen sich daran und empfehlen uns weiter.
Sie lesen das Buch kostenlos und tragen sich in unserer Leserliste ein, damit wir Sie über unsere Aktivitäten informieren können.
Sie lesen das Buch und spenden uns einen Betrag, den Sie für angemessen halten.
Sie lesen das Buch, indem sie es bei Amazon oder bei uns im Verlag für sich selbst oder zum Verschenken kaufen.
Mit herzlichen Tessiner Grüssen!
Roland Voser & Maurizio Vogrig
Verleger smartmyway
Cademario im Frühling 2025
Vielen Dank, dass Sie uns unterstützen!
Ich möchte freiwillig etwas bezahlen.
Wir freuen uns über jeden Betrag, mit dem Sie unsere Arbeit unterstützen möchten.
Hier ist der Einzahlungsschein für Ihre Spende für die Kleine Welt im Tessin.
Schreiben Sie uns bitte, damit wir uns bei Ihnen bedanken können. Herzlichen Dank!
Ich möchte das Buch in klassischer Form lesen.
Wir freuen uns über Ihren Kauf bei Amazon. Innerhalb der Schweiz liefern wir auch direkt vom Verlag.
Die Tessiner Tagebücher von Kathrin Rüegg.
In den letzten 5 Jahren hat der Schweizer Verlag smartmyway in vielen unentgeltlichen Stunden Kathrin Rüeggs Bücher neu aufgelegt, weil die lebensbejahenden Geschichten dieser bemerkenswerten Unternehmerin aktueller denn je sind und ein neues Publikum erreichen sollen.
Der Verlag präsentiert 2025 dieses ideelle Projekt erstmals komplett mit den neun Tessiner Tagebüchern in Taschenbuchform als Einzelbände und in drei Sammelbänden, sowie den zwei dazu gehörenden Bildbänden. Sogar eine englische Version gibt es jetzt vom ersten Band.
Kleine Welt im Tessin von Kathrin Rüegg.
Erstes Tessiner Tagebuch.
Ein Lesebuch von smartmyway.
Kapitel 5.
AUGUST
Wilhelm Tell auf dem Monte Waldo
Ich hatte es schon früher so gehalten: Am ersten August, dem schweizerischen Bundesfeiertag, wird bei mir nicht gearbeitet. Auch wenn alle andern Geschäfte offen waren, hatte ich jeweils ein Kärtchen „Wegen Feiertag geschlossen“ an die Schaufenster geheftet. Und hier sollte es nicht anders sein.
Zuerst erhielt Michelangelo seine tägliche Blockflötenlektion. Er wünschte sich sehnlich, dieses Instrument zu spielen. Seit bald einem Monat plagte er mich und ich ihn mit Musikunterricht. Aber er begriff es einfach nicht. Über den ersten Satz von „Quattro cavai che trottano“, für den es nur zwei Töne, G und A, braucht, kam er nicht hinaus.
„Schwer ist das“, seufzte er. „Ich habe immer geglaubt, man müsse nur die Worte eines Liedes in die Flöte sprechen, dann kämen vorn die richtigen Töne heraus.“ Aber er übte mit rührendem Eifer. Grano schmerzten offenbar die Ohren. Er jaulte leise.
„Siehst du, wie Grano meine Musik gefällt? Er singt mit.“ Gegen Mittag besuchten uns zwei alte, liebe Freunde, Ketti und Pitt. Sie kamen beladen mit zwei riesigen Einkaufstaschen und einem ganzen Rucksack voll Wein und Bier. Und unterwegs hatten sie Ugo angetroffen, der ebenfalls mit ein paar Weinflaschen auf dem Weg zu uns war.
„Hurra, unser Grotto wird eingeweiht – und die Gäste bringen den Wein gleich selbst mit.“
Michelangelo war im Element. Er mußte doch unsern Freunden zeigen, wie gut er seine Sache als Wirt auf dem Monte Valdo machte.
Er tischte Käse auf, Brot und Salami und öffnete gleich drei der mitgebrachten Fiaschi. Sechs Liter Wein für fünf Personen. Das würde ja gut werden! Aber heute war schließlich der Tag des Rütlischwurs. Wenn es auch sechshunderteinundachtzig Jahre her war, es lohnte sich wie eh und je, ihn zu feiern.
Wir aßen, schwatzten, tranken und sangen, genossen das Lüftchen, das über den Platz strich, und fanden die Welt schön. Michelangelo schenkte fleißig nach. Sein Glas war oft leer, das der andern meist noch fast voll. Aber die sechs Liter Wein genügten nicht. Eine neue Flasche wurde geöffnet. Als sich unsere Gäste verabschiedeten, war Michelangelo wieder in dem Stadium, wo er Vokale kaum mehr aussprechen konnte.
Am Himmel zog ein Gewitter auf. Ich war müde, mein Fuß schmerzte entsetzlich, und zudem war ich wütend auf Michelangelo. Er merkte es und zog sich scheu in den Keller zurück.
„Schwapp“, sagte der Korken, als er ihn aus der Flasche zog.
Zornausbrüche mit verstauchtem Fuß sind nicht sehr wirksam. Ich versuchte deshalb ein neues Mittel.
„Gute Nacht“, sagte ich um sieben Uhr. „Ich mag nicht mit einem Betrunkenen den ersten August feiern.“
Ich humpelte in mein Zimmer, schloß geräuschvoll die quietschende Tür und kochte vor Wut.
Michelangelo kramte allerhand herum. Ich hörte, daß er die Butangasbombe verrückte, mit den Hunden sprach. Geschirr klapperte, ein weiterer Korken machte „schwapp“. Durch eine Mauerritze spähend sah ich, daß Michelangelo auf dem Rand des Zisternenbrunnens saß, ein Glas in der Hand. Neben ihm lag die Blockflöte.
Wenn er nüchtern Flöte spielte, war es schon qualvoll genug. Aber sein Konzert zur schweizerischen Bundesfeier, dargeboten nach ich weiß nicht wie vielen Litern Wein, war grauenvoll. Trotz der Hitze verkroch ich mich in den Schlafsack und zog ihn auch noch über den Kopf. Ich döste. Schreckliche Alpträume verfolgten mich.
Vor dem Haus lärmte ein Menschenauflauf. Eine erregte Frauenstimme rief etwas. Ein Mann schien sich mit einem zweiten zu streiten. Ein dritter schrie: „Der Knabe lebt!“ Dann schwirrten viele Rufe durcheinander. Von einem Apfel war die Rede.
Mochten die da draußen toben. Mochten sie meinetwegen Michelangelo umbringen. Nichts konnte mich dazu bewegen, wieder aus dem Schlafsack zu kriechen. Im Halbschlaf hörte ich dem Streit der Männer zu. Auf italienisch streiten, tönt viel dramatischer. Dann sagte einer etwas von einer „seconda freccia“ – dem zweiten Pfeil. Ich erwachte, erinnerte mich an mühsames Auswendiglernen in der Schule: „Du stecktest noch einen zweiten Pfeil zu dir. – Ja, ja, ich sah es wohl. – Was meintest du damit?“
Schillers Wilhelm Tell auf italienisch!
Das Radio sendete das Drama zur Feier des Tages, und Michelangelo hatte den Transistor auf höchste Lautstärke eingestellt, wahrscheinlich, damit ich auch etwas davon hätte.
Wütend schlug ich in Ermangelung eines würdigeren Opfers auf mein Kissen. Dann legte ich es über den Kopf und hielt mir obendrein die Ohren zu. Die ganze Welt konnte mir gestohlen werden. Inklusive Michelangelo, Friedrich Schiller und dem Wilhelm Tell.
Die Feuerwerke von Locarno und Ascona knallten auch durchs Kopfkissen. Es war drückend schwül. Wenn es doch nur endlich, endlich regnen würde!
Die Regenküche
Während der ganzen Nacht zuckten Blitze, hallten Donnerschläge. Doch der Regen kam nicht.
Michelangelo hatte unsere Küche vorsichtshalber ins Haus geräumt. Nach dem gestörten Schlaf und mit dem schmerzenden Fuß sollte ich nun auch noch die unbequeme Kocherei im Haus auf mich nehmen.
„Räum sofort alles wieder ins Freie“, befahl ich ihm. Ich sagte nicht einmal „Bun di – guten Morgen“.
„Wie du willst“, antwortete er bescheiden. „Kochen ist schließlich deine Arbeit, und wenn es dir gefällt, naß zu werden …“ Er zuckte mit den Schultern.
Kaum war alles wieder an seinem Platz, da begann es zu tröpfeln. Ich spannte meinen roten Schirm auf und hielt ihn über den Kocher, damit es nicht ins bald siedende Kaffeewasser regnete. Dann fand ich in der Mauer ein passendes Loch. Dort hinein steckte ich den Griff des Schirms.
Aus den Regentröpfchen wurden Tropfen und aus den Tropfen ein förmlicher Sturzbach. Aus der Traufe, die in den Trog mündete, auf dem der Kocher stand, spritzte das Wasser. Der Schirm hielt dem Regen nicht mehr stand, stürzte herunter, riß Salz, Öl, Essig, alle meine Gewürze und was ich sonst noch auf dem Brett aufgebaut hatte, mit sich. Die Flaschen schwammen wie führerlose Schiffchen im Brunnentrog herum, die Verschlußdeckel lösten sich, und – gluck – der Schiffbruch war geschehen.
Michelangelo schaute grinsend zu. Ich versuchte zu erst, meinen Ärger hinunterzuschlucken, dann den aufsteigenden Lachkrampf zu verbeißen. Er merkte es. Wir blickten einander an. Und dann lachten wir. Wir standen im strömenden Regen und lachten wie die Narren. Ein Teil des Wassers, das uns übers Gesicht lief, waren Tränen. In der Zisterne rauschte der von den Dächern abfließende Regen.
„Regne, regne“, rief Michelangelo zum schwarzen Himmel. Ein greller Blitz und ein schmetternder Donnerschlag waren die Antwort. Es strömte und goß. Wir ließen uns durchnässen. Michelangelo holte seine sämtlichen Plastikeimer und stellte sie in einer Reihe auf.
„Damit putze ich mir während eines halben Jahres die Zähne, ich versprech‘s dir.“
Der Regen verwandelte das Erdreich auf dem Platz in einen bodenlosen Schlamm. Die Hunde patschten darin herum und schleppten einen schönen Teil davon ins Haus. Es regnete ununterbrochen während einiger Tage. Mein Fuß schmerzte immer mehr.
Schließlich hüpfte ich, gestützt von Michelangelo, auf einem Bein bis zum Auto. Im Spital von Locarno stellten sie fest, daß mein Knöchel nicht verstaucht, sondern gebrochen war. Ich bekam einen Gipsfuß und fühlte mich mitten im Sommer wie ein Ski-As.
Heimwärts hüpfen war viel einfacher. Dann legte ich mich auf ärztlichen Befehl ins Bett. Michelangelo übernahm auch meine Hausfrauenpflichten.
Als er von seinem nächsten Postgang zurückkam, brachte er ein zweimal umadressiertes Telegramm mit. Aus London.
Onkel Arthur schrieb:
„Ankomme Basel August 15. Gruß.“
Mein Onkel Arthur
In meinen Kinderjahren war Onkel Arthur eine sagenhafte Gestalt. Meine Mutter erzählte mir viel von ihrem älteren Bruder, der in jungen Jahren nach England ausgewandert war und in London einen fashionablen Damen-Frisiersalon führte. Herzoginnen und Gräfinnen seien seine Kundinnen, ja sogar die Königinmutter.
Wir erhielten von ihm jährliche Weihnachtsgrüße, die aber nach Kriegsausbruch ausblieben. Meine Mutter fürchtete, er sei umgekommen.
Vor ein paar Jahren war in meinem Geschäft ein distinguiert gekleideter weißhaariger Herr mit gepflegtem Bart erschienen.
„You must be Kathrin Rüegg. You look exactly like your mother“, stellte er fest.
Ich nickte.
Dann legte er zu meinem nicht geringen Erstaunen seine Hände auf meine Schultern und küßte mich rechts und links auf die Wangen.
„I am so glad to meet you. I am your uncle Arthur.“ Es stellte sich heraus, daß Onkel Arthur kein Wort Deutsch mehr sprechen konnte und auch nichts verstand. In Schweizerdeutsch war sein Wortschatz ebenfalls sehr gering: „Bohne mit Schpägg“ und „Guete Daag“. Damit hatte es sich. Seine Mutter – also meine Großmutter – hatte aus der französischsprechenden Schweiz gestammt. Französisch konnte er noch. Während des Krieges wollte er prinzipiell nicht mehr Deutsch sprechen, und so hatte er die Sprache einfach verlernt.
Er war ein schrulliges Männchen mit vielen kleinen Eigenheiten, die man auf schweizerdeutsch so liebevoll „Mödeli“ nennt. So war er zum Beispiel immer peinlich exakt gekleidet. Ich sah ihn kaum je ohne Krawatte, nie mit dem kleinsten Fleckchen auf dem blütenweißen Hemd. Er haßte es, irgend etwas anzufassen, was nicht ganz, ganz sauber war. Er geriet in Verzweiflung, wenn irgendwo eine Fliege saß, und hatte eine unheimliche Fertigkeit, sie mit der bloßen Hand zu fangen.
„You dreadful fly – du gräßliche Fliege“, sagte er dann zu dem armen Tier und zerquetschte es mit ein paar mahlenden Handbewegungen, die mir einen Schauer über den Rücken jagten. Nachher verschwand er eine gute Viertelstunde lang, „um sich zu desinfizieren“.
Der Pflege seines Bartes widmete er mehr Zeit als eine sehr eitle Frau dem kunstvollsten Make-up.
Onkel Arthur besuchte mich nun jedes zweite Jahr. Bei seinem dritten oder vierten Aufenthalt in der Schweiz verpaßte er mich, weil er unangemeldet hereinzuschneien pflegte. Ich konnte ihm dann beibringen, daß eine Voranzeige seines Besuches unbedingt nötig sei.
Zu Neujahr hatte ich ihm wohl ein Kärtchen geschickt, aber vergessen, ihm meine neue Adresse anzugeben. Wie gut, daß ich meine Freundin Helen in Basel hatte.
Ich setzte ein Telegramm an sie auf mit der Bitte, Onkel Arthur am 15. August am Flughafen abzuholen und in den nächsten Zug nach Bellinzona zu setzen. Dort würde ihn ein schwarzbärtiger Mann in rotem Hemd und Blue jeans erwarten.
Sehr gut fühlte ich mich nicht beim Gedanken, Michelangelo nach Bellinzona zu beordern und dort womöglich stundenlang auf Onkel Arthur warten zu lassen. Anders konnte ich es aber nicht machen, denn der Arzt hatte mir strengste Bettruhe befohlen.
Ich gab Michelangelo mit tausend Ermahnungen zehn Franken fürs Benzin und den Autoschlüssel. Er marschierte vergnügt davon.
Es dunkelte bereits, als zwei schaurig schöne Männerstimmen durch den Wald hallten. Einer sang „O sole mio“, der andere „It‘s a long way to Tipperary“, beides gleichzeitig natürlich. Sie erschienen Arm in Arm. Michelangelo beleuchtete den Weg mit einer Sturmlaterne.
Die beiden Männer hatten sich sofort gefunden. Weil es heiß war, hatte Onkel Arthur Michelangelo zu einem Bier eingeladen. Und aus einem Bierlein seien dann eben noch ein paar weitere geworden. Bier heißt schließlich in allen Sprachen ähnlich.
„What a nice place“, sagte Onkel Arthur, als er sich zum Abendessen niedersetzte. „Nur – der Weg hierher ist nicht besonders bequem. Wenn ich nicht unbedingt muß, werde ich nicht so schnell wieder weggehen. Übrigens – ist dieser Mann nicht ein bißchen zu ungezähmt und – hm – zu jung für dich?“ Er wies auf Michelangelo, der sich vergnügt eine zentimeterdicke Salamischeibe abschnitt.
Nun gab es viel zu erzählen. Onkel Arthur war der Meinung, ich verbringe auf dem Monte Valdo bloß meine Sommerferien. Es brauchte viele Erklärungen, bis er über alles genau im Bilde war. Ich hätte es richtig gemacht, fand er.
Onkel Arthurs Unterkunft war im Wohnzimmer unter meinem Schlafraum eingerichtet, wo Michelangelo während der Regentage den rußgeschwärzten Verputz abgeschlagen hatte. Die rohen Mauern sahen sehr schön aus. Verglaste Fenster gab es allerdings noch immer nicht. Michelangelo stellte Onkel Arthur sein Bett zur Verfügung und schlief jetzt auf einem ebenso knarrenden Liegestuhl wie ich.
Daß es primitiv sei, störe ihn nicht, tröstete mich Onkel Arthur, es gebe nur ein sehr heikles Problem:
„Your water closet without water is not very comfortable, ich brauche mit meinen sechsundsiebzig Jahren etwas, worauf ich mich niederlassen kann.“
Michelangelo hämmerte und sägte bis um Mitternacht. Dank Onkel Arthur kamen wir zum Luxus, uns am bewußten Örtchen sogar setzen zu können.
Meine Sorge, Onkel Arthur werde sich langweilen, erwies sich als höchst unbegründet. Er vermißte zwar seine tägliche „Times“ und suchte am ersten Morgen vergeblich den Stecker für seinen elektrischen Rasierapparat.
„Macht nichts, Regenwasser ist gut für die Haut, und sicherheitshalber habe ich immer noch Seife und ein Messer bei mir.“
Einen halben Herrensalon kramte er hervor: Serviette und Spiegel, einen Lederriemen, um das Messer zu schleifen, und ein Scherchen. Dann suchte er den bestgeeigneten Platz für seine Toilette und installierte sich schließlich unter der Stalltreppe. Dort sei das Licht am besten.
Michelangelo war förmlich empört, daß man wegen eines Bartes solche Zeremonien durchführen müsse. Seiner sei praktischer. Er habe ihn seit seinem letzten Geburtstag am achtzehnten September des letzten Jahres nicht mehr berührt. Und die Haare auch nicht.
Das Verhalten der beiden so verschiedenen Männer war drollig. Jeder war ein bißchen eifersüchtig auf den andern. Infolge der verschiedenen Sprachen blieb diese Eifersucht auf Bemerkungen beschränkt, die sie über einander zu mir machten. Nach ein paar Tagen hatte sich das aber gelegt, und wir bildeten ein fröhliches Trio. Wenn sie sich von mir unbeobachtet glaubten, versuchten sie auch, sich zu verständigen, und taten das mit Augen, Händen und Füßen.
Die Tiere waren Onkel Arthurs großes Glück. Bimbo darling, Susi darling, Grano darling und Bona darling interessierten sich sehr für das neue Mitglied unserer Familie. Michelangelo und ich zählten nicht mehr. Onkel Arthur beschäftigte sich vom Morgen bis zum Abend mit ihnen. Einzig wenn er auf Schmetterlingsfang ausging, waren sie sich selbst überlassen.
Als Junge habe er eine Schmetterlingssammlung besessen, erzählte er mir. Er war außer sich vor Freude, als er die Schwärme der vielen Falter sah, und wünschte sich sehnlichst ein Schmetterlingsnetz. Michelangelo suchte sämtliche Läden in Bellinzona, Locarno und Ascona danach ab, aber das gab es nirgends mehr zu kaufen. Onkel Arthur entschloß sich, nächstes Jahr Schmetterlinge zu züchten.
Er wußte, daß diese hübschen Geschöpfe am liebsten Appenzellerkäse riechen. Michelangelo brachte uns ein Stück. Wir legten es auf ein Tellerchen, und wirklich, bald darauf ließ sich ein wunderschöner Falter darauf nieder. Die Unterseite der Flügel war unregelmäßig braun-schwarz-weißgestreift, gegen den Saum zu leuchtete ein schwarzes Auge aus einem goldgelben Fleck. Die Oberseite war dunkelbraun mit weißen Punkten. Wenn der Schmetterling die Flügel bewegte, verwandelte sich das Dunkelbraun in ein sattes Violettblau.
„Das ist ein Männchen der ,Apatura iris‘“, erklärte mir Onkel Arthur. Als ich dann von meinem Bruder zu Weihnachten ein Schmetterlingsbuch geschenkt bekam, fand ich heraus, daß diese Art auf deutsch Schillerfalter heißt.
Dann gab es Perlmutterfalter, Trauermäntel, Pfauenaugen, Schachbrettfalter, Schönbären, Nessel- und Zitronenfalter, Wolfsmilchund Oleanderschwärmer. Einer mit Fühlern wie Radarantennen hieß Nagelfleck. Ich verbrachte meine Liegezeit damit, bei Onkel Arthur Unterricht in Schmetterlingskunde zu nehmen.
Bei vielen Arten sagte er mir, sie seien sehr selten.
Mein Schmetterlingsparadies mußte ich hüten. Ich würde in meinem Garten niemals Schädlingsbekämpfungsmittel anwenden. Zum Naturschutzgedanken gesellte sich auch die Überlegung, daß Monte Valdo wohl bald als einziger Ferienort der Schweiz seinen Gästen den Anblick so vieler Schmetterlingsarten bieten konnte.
Abends spielten wir Schach; Onkel Arthur war ein schlechter Verlierer und konnte sich stundenlang ärgern, wenn er sich eine Blöße gegeben hatte. Nachdem es mir zweimal hintereinander gelungen war, ihm einen ungedeckten Turm einfach wegzuschnappen, wurde er unendlich vorsichtig und brütete während Ewigkeiten über seinem nächsten Zug. Dann umflatterte ein Oleanderschwärmer oder sonst ein Insekt die Petrollampe. Onkel Arthur eilte, es vor dem sengenden Licht zu retten, machte vorher in der Hast irgendeinen unbedachten Zug auf dem Schachbrett, und schon war er matt.
„Oh, damned, damned, damned“, brummte er dann in seinen Bart, „what a fool I am.“
Um ihm die Sache einfacher zu machen, spielte ich nun am Anfang einer Partie so, daß er mir die Dame rauben konnte. Das war sein höchstes Glück. „Jetzt wird‘s spannend.“
Michelangelo saß ein wenig verloren daneben, versuchte, unser Spiel zu verstehen. Meine Erklärungen waren aber so nutzlos wie der Flötenunterricht.
Als Michelangelo aus dem Garten den abgebrochenen Zweig einer Tomatenstaude brachte, der voller grüner Früchte hing, entdeckten wir ein anderes Talent Onkel Arthurs.
„Je me souviens que ma mère faisait une confiture délicieuse“, sagte er zu mir. Wenn er von seiner Mutter sprach, verfiel er immer ins Französische.
„Roba da matt – verrücktes Zeug – aber doch nicht aus grünen Tomaten!“, protestierte Michelangelo, als ich ihm Onkel Arthurs Vorhaben auseinandersetzte und ihn bat, noch ein paar Tomaten mehr aus dem Garten zu bringen.
Auf unserer nächsten Einkaufsliste standen neben viel Zucker ein paar Gewürze und Zitronen.
Onkel Arthur zerschnitt mit peinlicher Sorgfalt die diversen Ingredienzien und setzte sie aufs Feuer. Der Duft, der seinem Gebräu entströmte, erinnerte stark an Schweinefutter. Michelangelo und ich waren skeptisch.
Stundenlang brodelte es im Topf, feierlich wurde die Konfitüre schließlich in Trinkgläser abgefüllt, die unser Koch mit Cellophanpapier und einem Gummiband verschloß. Ein einziges Glas ließ er offen für Versuchszwecke am morgigen Frühstückstisch. Die andern stellte er in den Keller.
Es muß gesagt sein: die Confiture de ma grand-maman war délicieuse.
„Mia maa – nicht schlecht“, sagte Michelangelo. Er, sonst allem Süßen abhold, löffelte sich ein ganzes Fuder aufs Butterbrot, so dick, daß es ihm rechts und links vom Mund in den Bart tropfte.
Gut, daß wir einen Vorrat davon hatten.
Leider muß auch gesagt werden, daß Onkel Arthur mir ein paar Tage darauf die in den Keller gestellten Gläser schreckensbleich ans Bett brachte. Sie waren alle leer.
Das ringsum überstehende Cellophanpapier und das Gummiband waren die einzigen Reste. Sonst waren die Gläser so sauber, daß man sie nicht einmal abzuwaschen brauchte. Ein hübsches, graues Tierchen mit einem buschigen Schwanz sei davongehuscht, berichtete Onkel Arthur. Susis Freund, dem Ghiro aus dem Mauerloch, schien Onkels Konfitüre so zu munden wie uns.