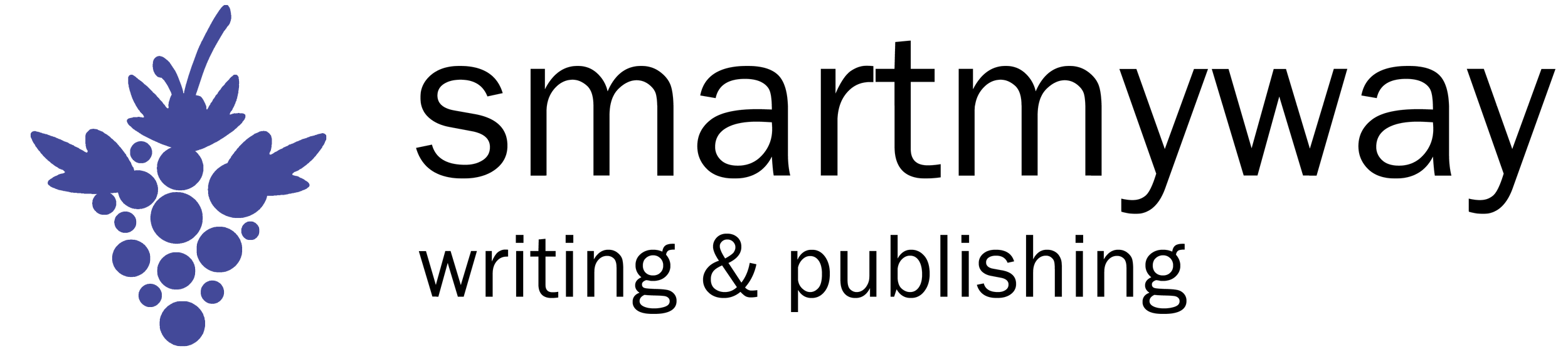Sie bezahlen, was Sie wollen.
Auf dieser Seite können Sie das Buch Kleine Welt im Tessin kostenlos lesen. In jener Schreibe, wie es die Autorin 1974 verfasst hatte. Wir veröffentlichen zum Start jede Woche ein neues Kapitel. Sie entscheiden, wie Sie die weitere Verlagsarbeit von smartmyway unterstützen möchten. Sie haben die Wahl:
Sie lesen das Buch kostenlos, freuen sich daran und empfehlen uns weiter.
Sie lesen das Buch kostenlos und tragen sich in unserer Leserliste ein, damit wir Sie über unsere Aktivitäten informieren können.
Sie lesen das Buch und spenden uns einen Betrag, den Sie für angemessen halten.
Sie lesen das Buch, indem sie es bei Amazon oder bei uns im Verlag für sich selbst oder zum Verschenken kaufen.
Mit herzlichen Tessiner Grüssen!
Roland Voser & Maurizio Vogrig
Verleger smartmyway
Cademario im Frühling 2025
Vielen Dank, dass Sie uns unterstützen!
Ich möchte freiwillig etwas bezahlen.
Wir freuen uns über jeden Betrag, mit dem Sie unsere Arbeit unterstützen möchten.
Hier ist der Einzahlungsschein für Ihre Spende für die Kleine Welt im Tessin.
Schreiben Sie uns bitte, damit wir uns bei Ihnen bedanken können. Herzlichen Dank!
Ich möchte das Buch in klassischer Form lesen.
Wir freuen uns über Ihren Kauf bei Amazon. Innerhalb der Schweiz liefern wir auch direkt vom Verlag.
Die Tessiner Tagebücher von Kathrin Rüegg.
In den letzten 5 Jahren hat der Schweizer Verlag smartmyway in vielen unentgeltlichen Stunden Kathrin Rüeggs Bücher neu aufgelegt, weil die lebensbejahenden Geschichten dieser bemerkenswerten Unternehmerin aktueller denn je sind und ein neues Publikum erreichen sollen.
Der Verlag präsentiert 2025 dieses ideelle Projekt erstmals komplett mit den neun Tessiner Tagebüchern in Taschenbuchform als Einzelbände und in drei Sammelbänden, sowie den zwei dazu gehörenden Bildbänden. Sogar eine englische Version gibt es jetzt vom ersten Band.
Kleine Welt im Tessin von Kathrin Rüegg.
Erstes Tessiner Tagebuch.
Ein Lesebuch von smartmyway.
Kapitel 7.
NOVEMBER
Spinat, die Pille und noch ein Abschied
November in der Stadt war für mich ein Greuel. Im Tessin ist der ganz späte Herbst eine der faszinierendsten Jahreszeiten. Das Wetter ist meist beständig, die Sicht klar; sobald die Sonne scheint, wird es herrlich warm.
Wir hatten ein großes Stück des Gartens gerodet und Spinat angesät. Die Blättlein sproßten bereits, und wir freuten uns auf unser eigenes Gemüse. Da kamen die Hunde auf die Idee, ihre täglichen Knochen ausgerechnet dort erst zu ver- und später wieder auszugraben.
Innert ein paar Tagen war unser Garten total zerwühlt und die ganze Ernte vernichtet.
Merke: Wer Hunde hat, muß seinen Garten einzäunen.
Ich erkundigte mich nach dem Preis von dreißig Meter Maschendraht in einem Meter Breite. Einhundertachtzig Franken!
Das hätte ich mir vor dem Bankkrach bedenkenlos geleistet, so aber entschloß ich mich, von Michelangelo einen Zaun aus Kastanienstämmchen machen zu lassen. Ich mußte mich daran gewöhnen, die Materialien zu verwenden, die auf dem Monte Valdo gratis zur Verfügung standen.
Als Michelangelos Zaun, ein absolutes Meisterwerk mit einem Türchen und einem rührend primitiven Riegelchen, fertig dastand, war ich über meinen Geldmangel direkt froh. Maschendraht wäre häßlich gewesen, ein Fremdkörper. Der Holzzaun sah so aus, als ob er schon immer dagestanden hätte. Oder wie wenn er gewachsen wäre, leider ein bißchen zu spät, um unsern Spinat vor den grabenden Hunden zu schützen.
Die Abende wurden lang. Ich hatte meine Strickarbeit, Michelangelo malte beim Schein der Butangaslampe, einer Petrollampe mit reflektierendem Spiegel und zweier Kerzen. Er behauptete, diese Lichtmischung ergebe wunderbare Farben.
Michelangelos Bilder berührten mich. Sie waren primitiv, oft in der Perspektive falsch, hatten harte, dunkle Konturen. Eines zeigte einen bärtigen Mann, den Hut auf dem Kopf, vor einer Flasche und einem Glas an einem hellgrünen Tisch sitzend. Der Hintergrund war giftig gelb. Das Bild hieß „Ich“. Michelangelo mußte sich sehr einsam fühlen …
Und ich mußte für ihn eine Gärtnerin finden!
Um diesem Ziel ein bißchen schneller nahezukommen, nahm ich trotz der Beschlüsse des Kriegsrates einen Einrichtungsauftrag an. Eine meiner treuen Kundinnen hatte mich gebeten, sie bei der Einrichtung ihres neuen Hauses zu beraten. Das würde mich nicht zuviel Zeit kosten, und die Gärtnerin rückte damit näher. Es bedingte aber, daß ich Michelangelo und die Tiere etwa zwei Wochen lang allein ließ.
Die Vorbereitungen, die ich für meine Abwesenheit traf, hätten auf eine längere Reise schließen lassen. Die Lebensmittelvorräte würden für mindestens einen Monat ausreichen. Zwanzig Liter Wein und zwei Flaschen Grappa waren auch im Keller. Michelangelo hatte mich flehentlich um eine „bella scorta“ – einen schönen Vorrat – gebeten. Für den Fall, daß ich in vierzehn Tagen nicht zurückkäme, gab ich ihm fünfzig Franken als Notreserve. Er mußte dann zu Fuß nach Sassariente und würde auf der Post einen Brief von mir und eventuell mehr Geld finden.
Was ich ihm täglich ein paarmal einbläute, war Susis Pille. Er hatte zur Sicherheit, damit er das ja nicht vergesse, ein riesengroßes Plakat geschrieben und an die Haustür geheftet: „Pillola Susi – non dimenticare!!!“ Susi verlangte recht zur Unzeit nach einem Kater, tat dies mit dem typischen „Mrraaaooo“ kund und wälzte sich auf der Erde. Offenbar wollte sie Bimbo noch nicht ganz allein lassen und kam wenigstens zum Frühstück immer heim. Dann hatten wir Gelegenheit, ihr die Pillola zu verabreichen, die Hälfte eines stecknadelkopfgroßen Kügelchens. Michelangelo übte an Bimbo, wie man einer Katze Tabletten eingibt. Mit seinen klobigen Fingern war das ein schwieriges Unterfangen, doch lieber das, als kleine Kätzchen töten zu müssen.
Bimbo Seidenglanz war nicht nur die hübscheste, sondern auch die gutmütigste Katze, die ich je kennenlernte. Er würgte nach einem guten Dutzend fehlgeschlagener Versuche die vorbereiteten Brotkügelchen brav hinunter. Bis Michelangelo es auch bei Susi fertig brachte, daß sie die Pille schluckte und nicht gleich verächtlich wieder ausspuckte, brauchte es ein paar Tage und ein ganzes Röhrchen der kostspieligen Arznei.
Dann kramte ich meinen Koffer mit den Kleidern für die Stadt hervor. Zum Glück machte ich am Abend vor meiner Abreise eine Art Kostüm-Hauptprobe. Alles schlotterte an mir. Die Hosen meines hübschen Anzugs waren so viel zu weit, daß sie mir gleich auf die Füße hinunterrutschten. Ich mußte mindestens zwölf Kilo abgenommen haben.
Bis spät in die Nacht machte ich die Nähte enger. Ich nähe schrecklich ungern. Weil ich aber an meine neue schlanke Linie dachte, war es diesmal ein reiner Genuß.
Während meiner Arbeit rechnete ich aus, wieviel ich in einem Jahr für meine Kleider ausgegeben hatte. Ich kam auf gut zweihundert Franken, denn außer zwei Paar Blue jeans, den Gummistiefeln und dem Straßenarbeiterumhang samt Hut hatte ich nichts gebraucht. Ein Koffer mit Wäsche lag unberührt immer noch in Froda.
Zum Leben in der Wildnis braucht man eigentlich nicht mehr als einige Pullover und Blusen und drei Paar Blue jeans – das sauber gewaschene Paar „für schön“, das zweite zum Arbeiten, und das dritte hängt an der Wäscheleine.
Michelangelo und alle Tiere begleiteten mich bis zum Parkplatz. Das kleine Grüppchen stand ein bißchen verloren am Wegrand und wurde im Rückspiegel des Autos immer kleiner. Michelangelo winkte, bis ich in die Straße einbog. Hoffentlich ging alles gut, bis ich wieder heimkam. Eine Mutter, die fünf Kinder im Wald allein lassen muß, konnte nicht besorgter sein als ich.
Ich und die Stadt
Dreißig Jahre hatte ich in der Stadt gelebt und gemeint, alle ihre Winkel zu kennen. Jetzt, nach einem guten Jahr schon, war sie mir fremd geworden. Ich fühlte mich wie eine Katze, die in einer unbekannten Stube schleunigst unter ein Sofa kriechen will.
Der Lärm, den ich schon früher nie mochte, war jetzt noch unerträglicher, die benzinverpestete Luft ebenso. Man hatte neue Fahrvorschriften erlassen, neue Einbahnstraßen eingeführt, neue Verbote. Ich war verloren.
Das einzige, was ich wie ein Verschwender genoß, waren Wasser und Elektrizität. Baden, duschen, Haare waschen, so oft ich wollte, und sogar mit warmem Wasser, und mit so viel Wasser, wie ich wollte. Welch ein wunderbarer, unbeschreiblich herrlicher Luxus! Und am Schalter zu drehen und Licht zu haben, oder den Hörer abzuheben und telefonieren zu können, sogar vom Bett aus. Oder ein Heizkissen anzustecken, oder den Backofen einzuschalten.
Was mich von ganz hoch oben mitleidig auf die Städter hinabblicken ließ, waren die neuen Vergnügungen der High-Society. Freunde luden mich ein, den neusten Club kennenzulernen. Es war fashionable geworden, in jenem Club zu turnen, auf einem Apparat radzufahren, die Männer durften allerhand Gewichte heben. Man machte Kniebeugen, Rumpfbeugen, dehnte und streckte sich, schwitzte in der Sauna, erholte sich unter der Höhensonne und atmete in einem Extraraum extrasaubere Luft.
Das alles konnte ich auf dem Monte Valdo auch haben. Gartenarbeiten waren so gut wie allgemeine Gymnastik, Kartoffelgraben ersetzte Kniebeugen. Anstatt Rad an Ort zu fahren, war ich wöchentlich ein paarmal vom Monte Valdo zum Parkplatz und zurück gelaufen, beladen wie ein Packesel. Meine Sauna war im Wassergraben ohne Wasser, die Sonne war auch da, und extrareine Luft hatte ich sowieso, vierundzwanzig Stunden täglich. Und alles ohne einen Rappen Clubbeitrag. Ich war immer noch reich. Nur ziemlich arm an Geld. Mein Einrichtungsauftrag machte mir Spaß. Zum erstenmal arbeitete ich unbelastet von allen Modeströmungen. Besonders für die Farbzusammenstellungen hatte ich neue Ideen. Ich mußte nur an den Monte Valdo denken, an den Waldboden, auf dem hellbraune Kastanienblätter lagen, an die grauen Mauersteine, das Grün der Brombeerranken. Irgendwo setzte ich das rote Tüpfchen einer Feuerlilie. Das waren meine Vorschläge für das Wohnzimmer.
Fürs Schlafzimmer guckte ich die Farben dem Pflaumenzipfelfalter ab: Der Teppich war grau-beige, der Bettüberwurf und die Vorhänge waren hellblau, die Polsterbezüge und kleinen Kissen auf dem Überwurf orange mit feinen schwarzen Borten.
Die Farben der Küche stahl ich der Raupe des Schwalbenschwanzes: Hellgrün, Rosa und Schwarz.
Das Bad war weiß, kastanienbraun und pinkfarben wie der Wolfsmilchschwärmer.
Meine Kundin war begeistert. Sie wollte mich gleich an eine Freundin weitergeben, die ihr Haus umbauen ließ. Zum Glück würde das Haus erst nächstes Jahr fertig sein. Meine vierzehn Tage waren um. Ich mußte zurück auf den Monte Valdo. Michelangelo hatte keinen Wein mehr. Ich sehnte mich auch nach den Tieren, besonders nach Bimbo.
So verwandelte ich mich denn wieder rückwärts, vom eleganten Schmetterling zur farblosen Puppe in verwaschenen Hosen und Gummistiefeln. Mit jeder Kurve, die mich näher zum Monte Valdo brachte, wurde mir wohler, und gleichzeitig stieg eine große Bangigkeit in mir hoch. War alles gut gegangen?
Der Weg abwärts durch den Wald war wie immer. Als ich mich den Häusern näherte, rief ich die Hun-
de. Sie kamen bellend angestürmt, rissen mich beinahe um, jaulten und tobten. Ich mußte mein Gepäck abstellen, um sie zu liebkosen. Während ich auf dem Mäuerchen am Wegrand saß und sie streichelte, erschienen miauend Susi und Bimbo. Sie drängten sich zwischen die Hunde und schmiegten sich schnurrend an meine Beine. Ich nahm sie auf den Arm, glücklich, alle wiederzuhaben. Als ich den Kopf hob, sah ich Michelangelo. Er stand breitbeinig im Weg, strahlte und fragte: „Hast du mir die versprochene Flasche Baselbieter Kirsch mitgebracht?“
Da war ich sicher, daß es meiner ganzen Monte-Valdo-Familie gut ging.
Michelangelo war während meiner Abwesenheit sehr fleißig gewesen. Er hatte das Dach meines Schlafzimmers zwischen den Balken mit Dachpappe abgedichtet, untendran Glaswolle geheftet, das Ganze mit Isolierplatten gedeckt und schließlich verputzt. Ich jubelte, denn der zeltartige Raum war einzigartig. Die dunkeln, zum Giebel aufstrebenden Balken hoben sich wunder bar vom weißen Verputz ab. Die Mauern waren nun innen auszementiert, das Fenster und die Türe eingesetzt. Das Loch, in dem Susis Freund, der Ghiro, schlief, hatte Michelangelo offengelassen, damit der arme Kerl sich nicht im Frühjahr in seinem Nest eingemauert fand.
In ein paar Tagen würden auch mein neues Bett und eine extradicke Matratze eintreffen und eine Decke aus Schafwollvlies mit einem Trikotüberzug. Ein paar Wärmflaschen und warme Hausschuhe für Michelangelo und mich hatte ich in meinem Gepäck, ebenso das Weihnachtsgeschenk meiner Verwandten, zwei Garnituren Angora-Unterwäsche, wie sie die Himalaja-
-Bergsteiger tragen. Mit dieser Ausrüstung würde ich den Winter überstehen, auch wenn es in meinem Schlafzimmer einmal weniger als null Grad war.
Der schöne Vorrat
Während meiner Abwesenheit hatte es bereits einmal geschneit. Der Schnee war zwar schon wieder geschmolzen, aber wir mußten uns sicherheitshalber doch so einrichten, daß wir zwei, drei Wochen unabhängig von irgendwelcher Warenzufuhr leben konnten. Michelangelo hatte am Listenmachen Gefallen gefunden und eine Aufstellung der seiner Ansicht nach lebenswichtigen Waren gemacht.
Zuoberst stand natürlich eine Korbflasche Wein. Endlich, endlich würde er dazu kommen, zu seiner „Damigiana“, die er eigentlich schon bei seiner allerersten Reise auf den Monte Valdo mitnehmen wollte. Position zwei waren fünf Liter Grappa. Das änderte ich ab in drei Liter, denn erstens war es unwahrscheinlich, daß wir während mehr als drei Wochen von der Außenwelt abgeschnitten sein würden, und zweitens kostete das zuviel.
Eine Reservebombe Butangas war sicher kluge Vorsorge. Michelangelo hatte auch an Toilettenpapier gedacht, an Reis, Teigwaren, Polenta, Salami, Mortadella, Luganighe, haltbares Gemüse wie Lauch, Kohl und Rüben, dann Getreideflocken und Dosenfutter für die Tiere.
Ich war schon auf dem Weg zu meinem Auto, als er mir noch nachrief: „Bring noch ein paar „Cicitt“ mit!“ Schade, daß diese Ziegenfleischwürstchen nicht bekannter sind. Man röstet sie ein paar Minuten lang auf der Glut. Sie sind stark geräuchert und haben ein wundervoll kräftiges Aroma. Und zu allem Glück sind sie billig – sechs Franken ein Kilo. Ich verdankte die Kenntnis dieser Spezialität der Metzgersfrau in Sassariente. Sie hatte offenbar bemerkt, daß ich mit meinem Geld sparsam umgehen mußte, und half mir rührend, möglichst preiswert einzukaufen.
Michelangelos Frage nach meiner Rückkehr war – wie könnte es anders sein: „Hast du die Korbflasche mitgebracht?“
„Mhm“, sagte ich.
Er machte sich sofort auf den Weg, um die ungefähr fünfunddreißig Kilogramm schwere Flasche vom Auto herunterzutragen. Als er nach einer Stunde immer noch nicht zurückgekehrt war, ging ich ihn suchen.
Bei der zweitobersten Wegbiegung fand ich ihn. Er hockte am Boden, war betrunken und schluchzte. Neben ihm lagen die Scherben der Flasche. Fast allen Wein hatte er vergossen und den Rest aus Verzweiflung getrunken.
„Welche Sorte war es?“, fragte er.
„Ving da past.“ Ich verschwieg ihm gnädig die Wahrheit, daß die Erde vom Monte Valdo sogar Barbera-getränkt war. Michelangelo war wie vor den Kopf geschlagen, todunglücklich. Was ist jetzt mit unserer bella scorta – dem schönen Vorrat? Den ganzen Tag über war er geistesabwesend. Am Abend hatte er die Lösung, ein wahres Ei des Kolumbus, gefunden: „Ich arbeite nun seit mehr als einem halben Jahr bei dir. Du hast doch gesagt, ich könne im Jahr drei Wochen Ferien haben, nicht wahr?“
„Ja, natürlich. Warum?“
„Also gut. Anstatt in die Ferien zu gehen – ich weiß ja doch nicht wohin –, hätte ich lieber eine neue Korbflasche voll Wein – aber diesmal Barbera, per piacere.“ Daß ich über die zerbrochene Korbflasche glücklich war, sagte ich ihm nicht. Aber seine Ferien hatten mir bleischwer auf dem Herzen gelegen. Ich hatte mir in glühenden Farben schon alle Dummheiten ausgemalt, die er dann anstellen würde.
Wir fällen Holz und haben Sorgen
Wenn die Bäume kein Laub mehr tragen, beginnt die Arbeit der Holzfäller. Wir hatten die Bäume markiert, die uns die Aussicht auf den See zu sehr verdeckten, und diejenigen, die uns jetzt zuviel Abendsonne wegnahmen.
Wir zogen also los mit Motorsäge, Säge, Axt und unsern Falci. Die Motorsäge zerschnitt mit ihrer Kette die Stämme, mit ihrem Gesumm wie tausend wilde Wespenschwärme auch die Luft. Zum Glück wußte Michelangelo, daß man zuerst einen Keil in den Stamm sägt, wie man mittels Seilen den Fall eines Baumes in eine bestimmte Richtung lenken kann, wie wichtig es ist, den gefällten Baum sofort abzuasten und wegzuräumen, weil man sonst in einem Gewirr von Stämmen und Ästen hilflos hängen und stecken bleibt.
Wir sortierten die geraden Stämme, die wir als Dachträger brauchten, die dünneren schönen Stücke für den Balkon vor dem Heuboden des Stalles, diejenigen für die Pergola, einen Vorrat für eventuelle weitere Zäune, den Rest als Brennholz.
Das Wetter war seit ein paar Wochen wunderschön. Ein klarer Tag reihte sich an den andern. Morgens bedeckte ein Reif die Dächer und die Wiese, gegen zehn Uhr wurde es so warm, daß wir draußen aßen. Das Radio warnte vor der Waldbrandgefahr.
Man muß es mit eigenen Augen gesehen haben, wie staubtrocken ein Kastanienwald im Winter sein kann, wenn das gefallene Laub, vermischt mit dürren Farnkräutern, den Boden fast kniehoch bedeckt.
„Was tun wir, wenn der Wald brennt?“ Diese Frage beschäftigte uns beide. Wäre es klug, in den Häusern zu bleiben? Die waren ja aus Stein. Aber wenn die Tragbalken der Dächer Feuer fingen und die Dächer dann einstürzten?
Wir entschlossen uns, die Wiese ganz sauber zu rechen. Wenn dort nichts lag, das brennen konnte, waren wir in der Mitte der Wiese wahrscheinlich am sichersten. Trotz der mageren Kasse kaufte ich einen Feuerlöschapparat, mit dessen Schaum wir auf der Wiese einen Kreis um uns herumziehen konnten.
Eines Abends entdeckten wir hoch über dem Lago Maggiore eine Rauchfahne. Als es dunkelte, wurden auch die Flammen sichtbar. Ein Feuergürtel hatte sich um den Gipfel des Berges gelegt. Der Wind blies die Glut offenbar aufwärts. Auch am andern Morgen brannte es noch.
Uns schauderte. Wir würden auf unser Feuer achten, es hüten wie eine heilige Flamme. Michelangelo entschloß sich, überhaupt nicht mehr zu rauchen, bis der Schnee fiel. Es schien ihm zu gefährlich. Und ich war dankbar dafür.
DEZEMBER
Gedanken und Gespräche
Abends wickelte sich immer daßelbe Programm ab. Die Tiere versammelten sich am Kamin. Ich setzte mich auf mein extrabequemes Baumstämmchen, das Radio nebendran, und strickte. Michelangelo kramte noch in seinem „magazzino“ herum oder spaltete im Stall beim Schein einer Petrollampe Holz. Dazu sang er ein Lied:
„Bella sei come un fiore, piena di poesia …“
Für ihn war die Welt in Ordnung, solange er ein Dach über dem Kopf, ein Stück Brot und eine Flasche Wein hatte. Ein warmes Feuer, ein Stück Salami oder Käse zum Brot, das waren schon Luxusgüter. Glücklicher Mensch!
Von seiner Vergangenheit wußte ich außer dem Handel mit der Pornographie immer noch nichts.
Einmal, als wir die Reportage von der Mondlandung der Apollo 17 verfolgten, sagte er: „Schließlich bin auch ich schon weit herumgekommen, nicht bloß diese Astronauten.“
Ich erwartete nun mindestens die Geschichte einer Amerikareise.
Er fuhr fort: „Weißt du, wo ich schon gewesen bin?“
„Du erzählst mir ja nie was.“
„Einmal, zum Beispiel, da war ich in Indemini. Dio mio, die vielen Kurven bis dorthin. Wir machten eine Schulreise. Fünf Franken kostete sie, stell dir das vor, einen ganzen Fünfliber.“
„Und wo warst du sonst noch?“
„Eh, dann kenne ich das ganze Locarnese wie meine Hosentasche.“
Wenn man weiß, daß Indemini in einer guten Autostunde von hier aus zu erreichen ist und daß das Locarnese, wenn man ganz großzügig schätzt, einen Durchmesser von zwanzig Kilometer hat, versteht man, wie groß Michelangelos weite Welt war.
„Erzähl mir doch ein bißchen, was du früher so gemacht hast“, bat ich ihn. Es war seltsam, mit jemand zusammenzuleben, dessen Charakter ich zu kennen glaubte, dessen Vergangenheit aber ein verschlossenes, nein, versiegeltes Buch war.
„Wie mich alle beschissen haben, das behalte ich für mich. Ich mag nicht darüber reden.“
„So erzähl mir von deiner Familie, wo du zur Schule gegangen bist, zum Beispiel.“
„Meine Familie ist für mich tot – oder ich für sie.
Das gehört mit zu dem, worüber ich schweige.“
Unser Gespräch verstummte. Ich wollte ihn nicht weiter plagen. Er sinnierte irgend etwas. Dann kam es, wie aus der Pistole geschossen: „Aber interessiert es dich vielleicht, daß ich Deutsch sprechen kann?“
„Was, du kannst Deutsch? Es wäre lieb von dir gewesen, mir das früher zu sagen. Ich strenge mich immer so an, versuche sogar, deinen Dialekt zu sprechen. Also, schieß los, zeig mir deine Künste.“
Ich erwartete nun: „Bitzeli sbasieren gehn“, das ungefähr alle Tessiner können. Er aber sagte: „Sbiegelei mit Schink, Rösti mit Sbiegelei, Rankfurter mit Kartoffsalat, Sändwitsch …“
„Halt, halt, Sandwich ist englisch!“
„Schön, in dem Fall kann ich eben auch Englisch, auch wenn mich Onkel Arthur nie verstand.“ Dann ratterte er weiter: „Eisgrem, Schnissel mit pomfritt.“ Eine vollständige Speisekarte in ungefähr deutscher Sprache.
„So, jetzt sag mir aber, wo du Kellner gewesen bist.“ Im Lido von Locarno hatte er nicht nur serviert, sondern auch gekocht, erzählte er mir nun. Dort hatte er gelernt, wie man einen Tisch deckt und wieder abräumt, daß man die gebrauchten Gläser nicht ineinander-, sondern nur zusammenstellt, daß man nie einen Gang mit leeren Händen macht.
„Bist ein Wunderkerl, Michelangelo, aber deswegen sprichst du die deutsche Sprache noch lange nicht. Oder was kannst du sonst noch?“
„Gumm schöön, zum Beispiel.“ Er hatte sich gegen Bona gedreht, die darauf aufstand, zu ihm ging und ihm den Kopf aufs Knie legte.
„Libi, libi“, sagte er zu ihr, und sie leckte ihm die Hand.
„Bösi Susi!“ Susi lag in ihrer Schachtel, erhob sich auf seine Worte, machte einen erschreckten Buckel und floh durch das kleine Katzentürchen, das der Schreiner vom Monte Valdo anno 1794 extra für sie ins Tor gesägt hatte.
„Grano, Platz!“ Grano legte sich brav und verstand nicht, warum Michelangelo ihm gleich darauf „pfui!“ zurief. Als Michelangelo ihn mit „Gum, Guti-guti“ lockte, war er wieder zufrieden.
„Bravo, Michelangelo, die Katzen- und Hundesprache in Deutsch beherrschst du ganz perfekt, bravo.“
„Wart nur, ich kann noch mehr.“
Was dann kam, erzähle ich nur der Vollständigkeit halber. Es ist kein Ruhmesblatt für die Lady Kathrin Rüegg. Denn wo anders als bei mir hatte er die folgenden Worte lernen können, die er jetzt hinunterleierte, wobei er sich nur unterbrach, wenn ihm der Schnauf ausging:
„Gopferdamevelogliniheubirliabenand, Immelaschunwolggebrugg, Verdamdesissdreg, Ergottonerundoria …“
Ein nimmerendenwollendes Vokabular an schweizerdeutschen Flüchen, mit Tessiner Akzent ausgesprochen. Ich hatte diese teils recht üblen Worte bei meinem früheren Chef gelernt – tausend Jahre war das mindestens her. Gut erzogen, hatte ich sie damals zur Kenntnis genommen, aber selbstverständlich nie angewandt. Hier im Dschungel, wo kein Mensch sie verstand, brachten sie mir in heiklen Situationen oder in solchen, wo ich vor Wut fast zerplatzte, Erleichterung. Und da hatte ich nun die Bescherung. Wenn Michelangelo irgendwem erzählte, wer ihm das beigebracht hatte! Es gab nur einen Ausweg, denjenigen über die
Mystik, die Michelangelo sehr faszinierte. Ich sagte:
„Du erinnerst dich, wann ich diese Worte jeweils brauchte?“
„Klar, immer wenn etwas schiefging.“
„Also, das sind Zauberworte wie ,Abrakadabra‘, aber auf schweizerdeutsch. Ich wandte sie nur an, weil ich glaubte, du verstehst sie nicht. Behalt sie gut für dich. Sonst nützt der Zauber nichts mehr.“
„Ich wußte ja immer, daß du eine Hexe bist“, sagte Michelangelo und schaute mich bewundernd an.
Erst als ich im Bett lag und unser Gespräch nochmals an mir vorbeiziehen ließ, merkte ich, wie schlau er mich wieder davon abgelenkt hatte, ihn über sein Leben auszufragen. Würde ich dieses Geheimnis je ergründen?
Die echten Marrons glacés vom Monte Valdo
Unser Vorrat an auserlesen schönen Kastanien wuchs. Wir waren schon beinahe entschlossen, ihn für unser Nachtmahl anzugreifen, als endlich das Rezept für Marrons glacés gleich von drei Seiten her eintraf.
Onkel Arthur schickte mir den Ausschnitt aus dem Briefkasten einer englischen Frauenzeitschrift, die er deswegen angefragt hatte. Meine Freundin Helen fand es – wie einfach! – in einem alten Basler Kochbuch, und der Bäcker von Sassariente erklärte mir lang und breit, wie man diese Köstlichkeit herstellt.
Erst muß man die Kastanien einschneiden, dann mit der Schale kochen, dann die dicke Schale abziehen, die Früchte weiterkochen, um die dünne Schale zu entfernen. Laut Basler Kochbuch konnte man das in einem Arbeitsgang machen. Wir fanden aber heraus, daß die Marroni schöner blieben, wenn man dem Rezept des Bäckers folgte.
„Man koche Zucker und Wasser mit Vanille zum Sirup und gieße diesen über die Kastanien“, hieß es dann.
„Sehr einfach“, sagte Michelangelo voreilig.
Laut Rezept des Bäckers mußte man diesen Sirup nun täglich von den Kastanien abschütten, durch Zugabe von noch mehr Zucker konzentrierter machen, und das während einer Woche. Und während der ganzen Zeit sollte man die Kastanien an einem möglichst warmen Ort aufbewahren. Das englische und das Basler Rezept schrieben nur zwei- bis dreimalige Wiederholung mit aufgewärmtem Sirup vor.
Da wir unsere Marroni verkaufen wollten, entschlossen wir uns, dem Rezept des Bäckers zu folgen. Ein bißchen verächtlich und wie alte Fachkonditoren taten wir die beiden andern Rezepte als „Hausfrauen-Gebrauchsanweisungen“ ab.
Vorerst starteten wir einen Versuch mit einer Menge, die bis auf zwei alle unsere Suppenteller füllte.
Schon das Schälen war eine qualvolle Arbeit.
„Ich grabe lieber nach Wasser, auch wenn ich dann keines finde“, brummte Michelangelo und warf den Hunden ärgerlich eine zerbrochene Kastanie zu.
„Laß mich das machen, deine Finger sind zu klobig dafür“, sagte ich mitleidig.
„Aber ich will auch helfen“, entgegnete er hartnäckig.
„Du darfst dafür den Zuckersirup kochen.“
„In dem Fall grazie, grazie tante. Ruf mich bitte, wenn du soweit bist.“ Pfeifend ging er in den Stall. Die Schläge der Axt verrieten, daß er Holz spaltete.
Die elfenbeinweißen Früchte auf den roten und blauen Emailletellern sahen hübsch aus. Zum Anbeißen hübsch, jetzt schon. Ich stellte sie ordentlich ausgerichtet auf den Kaminsims. Dort war es am wärmsten. Michelangelo kam mit einem Stoß Holz und entfachte das Feuer. Das Tessiner Kaminfeuersystem faszinierte mich immer aufs neue. Man nimmt drei etwa anderthalb Meter lange, möglichst dicke Holzstücke. Deren Spitzen legt man in den Kamin, der Rest ragt fächerförmig auf den Granitfußboden hinaus. Mit einer Zeitung und einem jämmerlich kleinen Häufchen Ästlein entzündet man unter den Holzspitzen das Feuer, und schon brennt es.
Noch nie hatte Michelangelo mehr als einmal anfeuern müssen. Wenn das brennende Stück zerfiel, wurde das Holz ein bißchen nachgeschoben. Das Feuer brannte und wärmte immer schön gleichmäßig und gab überhaupt keine Arbeit.
Irgendwie stand kein guter Stern über unserer Konditorei. Michelangelo wollte vorschriftsgemäß den Sirup zubereiten, doch erst mal zerriß der Zuckersack. Ein Teil des Inhalts ergoß sich auf Michelangelos Bett, der Rest rieselte auf den Boden. Michelangelo holte den Besen, wischte brummend auf, stellte den Besen schräg in die Ecke neben den Kocher und holte den Zuckervorrat aus dem Keller. Unter seinen Füßen knirschte es.
„Ich nehme bloß die Hälfte“, sagte er, als er wieder heraufkam. „Man kann nie wissen, was noch schief geht, und dann haben wir keinen Zucker mehr.“
Sorgsam maß er das Wasser ab, goß es zum Zucker, gab die Vanilleschoten bei, wollte die Flamme entzünden. Als er sich vorbeugte, trat er auf den schräggestellten Besen, der Stiel schnellte hervor, schlug gegen den Pfannenrand. Die Pfanne rutschte nach vorn und fiel mit großem Geklapper auf den Boden.
„Gopferdame …“ hub er an, schaute auf mich, stoppte und murmelte ganz schnell „Abrakadabra“.
Beim dritten Versuch gelang der Sirup.
Erst jetzt wischte er den Boden auf. Aber da war es schon zu spät.
Die Hunde hatten eifrig begonnen, die ungewohnte Süßigkeit aufzulecken, und waren dabei auch ein bißchen in die Brühe getreten. Auch Michelangelos Fußspuren zogen sich durch den Raum. Mitleidig wollte ich ihm helfen, rutschte aus und setzte mich genau dorthin, wo noch am meisten Sirup war. Die Katzen interessierten sich ebenfalls dafür und hatten durch meinen Plumps einige Spritzer abbekommen. Um es in einem Satz zu beschreiben: der ganze Monte Valdo klebte.
Ich weiß nicht, wie lange wir putzten und fegten.
„Jetzt verstehe ich, weshalb das Zeug so teuer ist“, sagte Michelangelo und nickte weise mit dem Haupte.
Drei Tage lang ging dann alles vorschriftsgemäß. Ich hatte von Sassariente neuen Zucker mitgebracht.
In der vierten Nacht erwachte ich ob einem Getöse, das aus Michelangelos Haus dröhnte. Es tönte genau, wie wenn Emailleteller auf den Boden fallen. Ich hörte Michelangelo fluchen. Diesmal auf italienisch.
Am Morgen zeigte er mir dann die Bescherung. Die Katzen hatten ungefähr sämtliche Marrons glacés (sie waren unterdessen schon ganz schön glacés geworden) angeknabbert. Diejenigen, die auf den Fußboden gefallen waren, hatten die Hunde gefressen.
Wer nicht glauben will, wie gern Katzen und Hunde Marrons glacés haben, der schenke seinem Liebling ein paar zu Weihnachten. Die Viecher können sie pfundweise fressen, es wird ihnen nicht einmal schlecht davon …
Wir aber gaben kopfhängend unsere diesbezüglichen Verdienstpläne wieder auf.
„Nächstes Jahr gehe ich eben doch nach Locarno als Marronimann“, sagte Michelangelo stur.
„Vielleicht hätte das mehr eingebracht“, entgegnete ich, „aber dann wäre mein Schlafzimmer nicht winterfest geworden. Du weißt doch, daß wir Geld mit Arbeiten verdienen müssen, die wir hier und möglichst abends machen können.
Was sollen wir nun tun? Ich bin dagegen, die Hände in den Schoß zu legen und zu jammern. Das Geld für den Esel haben wir beisammen, ein Stück vom Generator auch, aber große Sprünge können wir noch lange nicht machen.“
Wieder einmal hatte eine kleine Ursache, die verunglückten Marrons glacés nämlich, eine (vielleicht) große Wirkung.
„Erinnerst du dich noch an die pornographische Geschichte?“, fragte Michelangelo.
„Und ob – aber verschone mich definitiv und endgültig mit deiner Pornographie. Ich will nichts mehr davon wissen.“
„So laß mich doch ausreden. Ich wollte sagen: Du kannst doch schreiben. Schreib doch ein Buch!“
„Ich? Ein Buch? Über was denn?“
„Du bist viel gescheiter als ich. Und wenn ich jetzt nochmals etwas von Pornographie sage, springst du wieder einmal an die Decke oder sagst Abrakadabra auf schweizerdeutsch.“
Ich schaute in die Flammen des Kamins. Michelangelos Kopf mit der Knollennase, dem struppigen Bart und den langen, gelockten Haaren hob sich davor ab wie ein schwarzer Scherenschnitt.
Auf dem Kaminsims saßen die Katzen, leckten ihre Pfötchen und fuhren damit hinters Ohr. Zu unsern Füßen lagen die Hunde. Grano hatte den Kopf zwischen die Vorderpfoten gelegt, Bona war zu einem runden Hundeknäuel zusammengerollt. Beide schliefen.
In eine wunderliche kleine Welt war ich da hineingeraten, lebte zusammen mit einem Vagabunden in der Wildnis, in meiner eigenen Wildnis, notabene. Ich hatte in einem Jahr mehr gelernt und erlebt als in den vierzig Jahren vorher zusammengenommen. Ich hatte gelernt, wie einfach man leben kann und wie lebenswert das Leben erst dann wird, auch wenn man gegen tausend Schwierigkeiten kämpfen muß (dreimal „Leben“ hintereinander …).
Mein vertracktes inneres Stimmchen meldete sich wieder einmal: „Wie wäre es, wenn du über Michelangelo und die Tiere, über den Monte Valdo ein Buch schreiben würdest?“
„Hm?“ Ich zögerte und dachte nach. Die Idee wäre gar nicht so dumm. Es gäbe so eine Art mitteleuropäische Daktarigeschichte. Anstelle des Löwen Clarence schielte zwar nur ein Hund. Aber Bona konnte mindestens so pfiffig dreinschauen wie Judy, die Schimpansin. Susi Stäubli und Bimbo Seidenglanz mußten stellvertretend einspringen für alle Tiere vom Geparden
über den Tiger bis zum Schakal und Elefanten.
Schlangen und Siebenschläfer waren die von Zeit zu Zeit benötigten Bösewichter.
Wenn ich daran dachte, daß während des ganzen Sommers nur zwei verirrte Wanderer bei uns vorbeigekommen waren, dann durfte ich füglich behaupten, im Busch zu leben. Daß dieser Dschungel nur ein paar Kilometer von menschenüberfüllten Ferienzentren entfernt war, tat nichts zur Sache.
Michelangelo und Onkel Arthur? Ja, die ließen sich nirgends einreihen. Aber etwas Besonderes mußte meine Geschichte ja haben, nicht wahr?
„Aber“, sagte ich zum Stimmchen, „wir sind noch nicht am Ende. Wir haben noch kein Wasser, keinen Generator, keinen Esel. Ich kenne Michelangelos Lebensgeschichte immer noch nicht. Ja, wenn er jetzt zum Beispiel seine Gärtnerin gefunden hätte, könnte man das Buch mit der Beschreibung der Hochzeitsfeier beschließen.“ (Hoffentlich würde sich Michelangelo dann nicht zu sehr betrinken …)
„Schreib jetzt!“, befahl das Stimmchen. „Am Ende ist man erst, wenn man stirbt. Dein Buch soll schließlich kein Märchen mit Prinzenhochzeit sein. Wahre Geschichten hören selten beim Happy-End auf. Das Leben fließt schließlich immer weiter, und nie sind alle Rätsel gelöst.“
Weil das Stimmchen recht hatte, sagte ich so laut, daß Michelangelo und alle vier Tiere erschreckt zusammenfuhren: „Farèm!“
Wie Michelangelo Michelangelo wurde
Ich unterbreitete Michelangelo meine Idee.
„Wunderbar“, sagte er begeistert. „Und ich male dazu einen Buchumschlag, auf dem man unsere Häuser sieht mit der Wäschehänge und dem Spaltklotz, auf dem das Susi sitzt. Und Bimbo, Grano und Bona müssen auch drauf sein. Siehst du, etwa so.“
Er holte Zeichenblock und Kohle hervor und skizzierte mir, wie er sich‘s vorstellte.
„Und wie soll ich in der Geschichte heißen? Ich möchte lieber nicht, daß mein richtiger Name drin stünde.“
Er schaute von seiner Zeichnung auf, und ich wußte seinen Namen. Es gab ausschließlich den und keinen andern:
„Michelangelo.“
Ich sagte es ihm. Er war entzückt, aber so eitel, daß er fragend beifügte: „Auch Buonarroti?“
„No, Michelangelo e basta.“
„Ich bin auch so zufrieden.“
„Ungebildet ist er weiß Gott nicht, auch wenn seine Geographiekenntnisse nur bis Indemini reichen“, registrierte ich.
Noch am selben Abend begannen wir unser Werk, ich an der Schreibmaschine, er mit dem Zeichenblock.
Wir arbeiteten beide, still vertieft in unsere Pläne. Michelangelo konzentrierte sich so, daß er die Zungenspitze herausstreckte und sie beinahe abbiß.
Dann zeigte er mir seinen Entwurf. Er war herzig.
„Bravo, bravo“, rühmte ich ihn.
„Du, ich muß dich etwas fragen“, hakte er sofort ein.
„Ich hätte mich nie getraut, wenn dir das Titelblatt nicht gefallen hätte. Könntest du mir darauf nicht einen Vorschuß geben? Nur einen kleinen. So etwa vierzig Franken?“
„Du bist der gräßlichste Mensch, den der liebe Gott auf der Erde herumlaufen läßt! Ich weiß doch noch gar nicht, ob ich für das Manuskript je einen Verleger finde. Und überhaupt – für was brauchst du denn auf einmal Geld? Falls du mir ein Weihnachtsgeschenk machen möchtest, ich hätte viel lieber eine Zeichnung von dir.“ Er nestelte in seiner Tasche und zog eine gedruckte, an ihn adressierte Einladung hervor. Der Brief hatte bei meiner letzten Einkaufsfahrt auf der Post gelegen.
Michelangelo wurde herzlich gebeten, an der „Cena del secolo“ teilzunehmen.
Das Nachtmahl des Jahrhunderts
„Was ist denn das für ein Essen? Und wenn es nur alle hundert Jahre einmal stattfindet, wieso kommen die dazu, ausgerechnet dich einzuladen?“
Michelangelo erklärte es mir. Und ich bekam die Tessiner daraufhin noch ein bißchen lieber.
Es ist Brauch, daß ein paar Reiche Locarnos „alle, die gern essen und trinken“ jährlich einmal zu einem Mahl einladen. (Das war Michelangelos Version. Ich glaube aber eher, sie tun es für die, die nicht immer genug zum Essen und zum Trinken haben.)
Man bekommt ein Geschenk und kann von allem haben, soviel man will.
Wenn ich an die Portionen dachte, die Michelangelo da vertilgen würde, taten mir die Reichen von Locarno leid.
„Du solltest die Gestalten sehen, die da kommen“, schwärmte er. „Nur schade, daß jedes Jahr ein paar von ihnen fehlen. Ich weiß gar nicht, wo die dann hinkommen.“
„Wahrscheinlich in die Trinkerheilanstalt“, sagte ich trocken. Michelangelo wollte das nicht wahrhaben.
„Aber wenn doch alles gratis ist, wieso brauchst du denn vierzig Franken?“
„Stellst du dir vor, ich gehe so?“ Er zupfte an seinem Bart und zerwühlte sich sein ohnehin zerzaustes Haar.
„Ich muß ins Bagno pubblico gehen und dann zum Barbiere. Der muß mich in Schuß bringen und schön machen und parfümieren.“
Sicher, er sagte „profumare“.
„Michelangelo, hast du wirklich vor, an die Cena del secolo zu gehen, oder erwartet dich irgendwo ein Schätzchen?“
Er grinste nur übers ganze Gesicht.
Ich klaubte zwei Zwanzigernoten aus dem Geldtäschchen und gab sie ihm. Mochten sie ihm und mir Glück bringen.
Am Samstagnachmittag trottete er davon. Er wollte nicht, daß ich ihn ins Tal brachte, und auch nicht, daß ich ihn morgen früh irgendwo abhole.
„Ich komme per Autostopp mindestens bis Sassariente, den Rest mache ich mit dem Bus. Ciao, in gamba“, sagte er und tippte mit dem Zeigefinger von der Schläfe schräg aufwärts gegen den Himmel ein fröhliches Zeichen. Dann verschwand er im Wald. Ich hörte noch ein Weilchen seine Schritte im raschelnden Laub. In der Nacht kam der große Schnee. Ein fürchterlicher Sturm tobte. Er blies durch den Kamin. Die Asche flog mir ins Gesicht. Die Hunde legten sich als Teppich zu meinen Füßen. Susi lehnte gegen meinen Rücken, und Bimbo hatte es sich auf meinem Schoß bequem gemacht. So schrieb ich Seite um Seite, lachte über die Notfallapotheke, dachte mit Sehnsucht an Onkel Arthur. (War die Herzogin von Stoneville wohl noch immer nicht gestorben?) Mein Fuß begann zu schmerzen, als ich von der Freiluftküche schrieb.
Als ich so weit war mit meinem skizzenhaften Entwurf, dämmerte es. Es schien heller zu sein als sonst. Kunststück: der Monte Valdo war eingehüllt in eine gut halbmeterdicke Decke von feinstem, weichstem Schnee.
„Fein“, dachte ich als erstes, „eine Zeitlang müssen wir kein Wasser mehr tragen. Schneewasser, gekocht und filtriert, tut es auch.“
So leid es mir ist, aber in Sachen Trinkwasser habe ich eine richtige Deformation professionnelle bekommen. Zur Feier des Tages brühte ich nun Kaffee aus Schnee. Michelangelo würde sich freuen.
Michelangelo!
Mein Gott, bei diesem hohen Schnee konnte er gar nicht mehr zu mir gelangen. Die Straße wurde ja nicht gepflügt, und so blieb ein nicht schneegewohnter Mensch unfehlbar stecken. Und er hatte nur vierzig Franken bei sich, die sicher längst ausgegeben waren.
Es war mir bang. Ich dachte nicht mehr daran, daß ich die ganze Nacht durchgearbeitet hatte. Ich grübelte nur, was wohl mit Michelangelo geschehen war.
Um mich zu trösten, trank ich aus seiner „bella scorta“- und Ferien-Korbflasche eine ordentliche Portion Barbera. Nachher füllte ich meine drei Wärmflaschen, ging ins Bett und schlief, bis es wieder Nacht wurde. Dann weckten mich die Tiere. Sie hatten Hunger.
Es schneite jetzt nicht mehr. Die Schneedecke war aber noch höher geworden. Mir blieb gar nichts anderes übrig, als zu warten. Zu warten, bis entweder der Schnee wegging oder Michelangelo auftauchte.
Und anstelle eines Generators mußte zuerst ein Telefon her! Ich tat wieder einmal einen meiner Schwüre. Nach sechs Tagen, an denen es nicht kalt genug war, daß der Schnee gefror, und nicht warm genug, daß er schmolz, kam die Sonne wieder. Es wurde eisig kalt. Mein Weg wurde begehbar, wenn auch das Auto noch tief im Schnee steckte. Ich ging zu Fuß nach Sassariente, fuhr mit dem Bus nach Locarno und fragte jeden, der aussah, als bekäme er nicht immer genug zu essen und zu trinken, nach Michelangelo. Feststand jedenfalls, daß er am Nachtmahl des Jahrhunderts teilgenommen hatte – „und wie!“, sagte schmunzelnd ein zahnloser Alter.
Also würde ich ihn nicht durch die Polizei suchen lassen. Michelangelo sollte nicht wegen Vagabundierens festgenommen werden.
Ich kaufte Knochen und Fleisch für die Tiere und holte die Post ab. Wie zum Hohn sandte mir die Gemeinde Sassariente ausgerechnet heute die Baubewilligung. Ich war rechtschaffen müde, als ich wieder auf meinem Berg anlangte. Welch eine Weltreise war das doch. Und welch ein Unterschied zwischen der im Vorweihnachtszauber glitzernden Stadt und der Einsamkeit des Monte Valdo.
Es wurde Heiliger Abend. Ich schenkte jedem Hund einen Extraknochen und den Katzen eine Sonderportion Milch. Dann öffnete ich die vielen Briefe und Päckchen meiner Freunde. Die Kerzen brannten seit Mitte Oktober ohnehin jeden Abend; heute hatten sie einen besonders weichen Schimmer. Oder bildete ich mir das bloß ein?
Mein Christbaum war die Eiche, das Weihnachtslicht spendeten von oben die Sterne, von unten die Lichter der Dörfer am Seeufer. Wäre nicht die Sorge um Michelangelo gewesen, niemand hätte ein schöneres Weihnachtsfest gehabt als ich.
In der Silvesternacht hörte ich die Glocken der Dörfer im Tal. Wie schön wäre es gewesen, Michelangelo hier zu haben. Wo war er?
Ich weiß auch heute noch nicht, wohin Michelangelo verschwunden ist. Vielleicht schläft er wieder im Wartsaal von Locarno oder in einer Telefonkabine. Wenn mich nicht alles trügt, wird er eines Tages wieder aufkreuzen. So wie Susi Stäubli letzten Februar heimkehrte, als wäre nichts geschehen.
Dann werde ich nicht schelten und nicht fluchen, nur ein fröhliches Zeichen mit dem Zeigefinger von der Schläfe gegen den Himmel machen und sagen:
„Ciao.“ Falls er die Gärtnerin mitbringt, werde ich sie mit offenen Armen empfangen. Dank Michelangelo schlummert der Monte Valdo nur noch, er schläft nicht mehr. Wer weiß, dank einer Gärtnerin erwacht er vielleicht ganz.
Nie sind alle Rätsel gelöst.
Auf alle Fälle werde ich diese Geschichte Michelangelo widmen.
Monte Valdo, Mitte Januar 1973
PS: Er ist seit heute morgen wieder da!
Wie geht es wohl weiter auf dem Monte Valdo? Erfahren Sie, liebe Leserin, lieber Leser, alles darüber im zweiten Tessiner Tagebuch von Kathrin Rüegg:
Dies ist mein Tal – dies ist mein Dorf