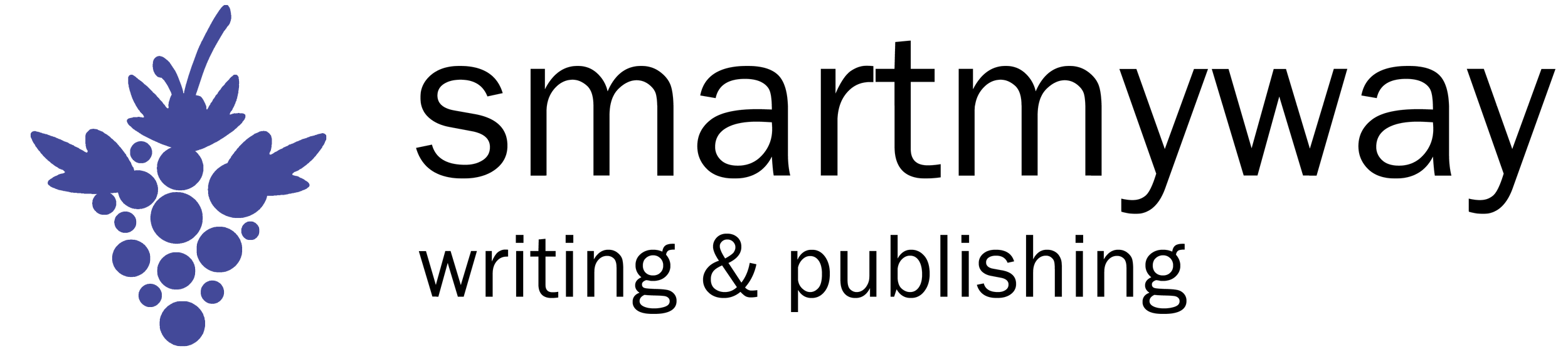Sie bezahlen, was Sie wollen.
Auf dieser Seite können Sie das Buch Kleine Welt im Tessin kostenlos lesen. In jener Schreibe, wie es die Autorin 1974 verfasst hatte. Wir veröffentlichen zum Start jede Woche ein neues Kapitel. Sie entscheiden, wie Sie die weitere Verlagsarbeit von smartmyway unterstützen möchten. Sie haben die Wahl:
Sie lesen das Buch kostenlos, freuen sich daran und empfehlen uns weiter.
Sie lesen das Buch kostenlos und tragen sich in unserer Leserliste ein, damit wir Sie über unsere Aktivitäten informieren können.
Sie lesen das Buch und spenden uns einen Betrag, den Sie für angemessen halten.
Sie lesen das Buch, indem sie es bei Amazon oder bei uns im Verlag für sich selbst oder zum Verschenken kaufen.
Mit herzlichen Tessiner Grüssen!
Roland Voser & Maurizio Vogrig
Verleger smartmyway
Cademario im Frühling 2025
Vielen Dank, dass Sie uns unterstützen!
Ich möchte freiwillig etwas bezahlen.
Wir freuen uns über jeden Betrag, mit dem Sie unsere Arbeit unterstützen möchten.
Hier ist der Einzahlungsschein für Ihre Spende für die Kleine Welt im Tessin.
Schreiben Sie uns bitte, damit wir uns bei Ihnen bedanken können. Herzlichen Dank!
Ich möchte das Buch in klassischer Form lesen.
Wir freuen uns über Ihren Kauf bei Amazon. Innerhalb der Schweiz liefern wir auch direkt vom Verlag.
Die Tessiner Tagebücher von Kathrin Rüegg.
In den letzten 5 Jahren hat der Schweizer Verlag smartmyway in vielen unentgeltlichen Stunden Kathrin Rüeggs Bücher neu aufgelegt, weil die lebensbejahenden Geschichten dieser bemerkenswerten Unternehmerin aktueller denn je sind und ein neues Publikum erreichen sollen.
Der Verlag präsentiert 2025 dieses ideelle Projekt erstmals komplett mit den neun Tessiner Tagebüchern in Taschenbuchform als Einzelbände und in drei Sammelbänden, sowie den zwei dazu gehörenden Bildbänden. Sogar eine englische Version gibt es jetzt vom ersten Band.
Kleine Welt im Tessin von Kathrin Rüegg.
Erstes Tessiner Tagebuch.
Ein Lesebuch von smartmyway.
Kapitel 2.
Michelangelo
Er war total betrunken und saß mit weit nach hinten geschobenem Stuhl am Wirtshaustisch. Den von lockigen, dunkeln Haaren und einem struppigen Bart umrahmten Kopf hatte er auf die linke Hand gestützt. Seine braunen Augen waren blutunterlaufen.
„Michelangelo schaut wieder einmal aus wie ein besoffener Wilhelm Tell“, bemerkte Gildo.
Ein paar Trinkkumpane amüsierten sich über ihn. Die Kellnerin hatte offenbar den Auftrag, sein leergetrunkenes Schnapsglas sofort wieder durch ein volles zu ersetzen. Sie tat es oft.
Ich verabschiedete mich nach einer Weile von meinen beiden Kollegen, ging auf den Betrunkenen zu und befahl ihm mitzukommen.
Woher ich diese Idee und den Mut zu ihrer Ausführung hatte, weiß ich nicht. Aber der arme Kerl tat mir leid.
„Si, S‘nora“, sagte er folgsam, erhob sich und stolperte hinter mir drein, sich an Tischen und Stuhllehnen, am Türrahmen und schließlich am Auto festhaltend. Die zechenden Männer brachen nach einer kurzen, betretenen Pause in ein schallendes Gelächter aus und grölten hinter uns drein: „Che bella coppia! – Welch schönes Paar.“
Das waren wir auch. Ich in verwaschenen, schlotternden Blue jeans, einem Pullover in undefinierbarer Farbe und vom Zement staubigen Haaren. Er in zerschlissenen Hosen, einem grasgrünen Hemd, ein feuerrotes Tuch um den Hals geschlungen.
Maria wollte ihn gleich wieder hinauswerfen. Sie schalt mich: „Bist du wohl übergeschnappt? Hier ist kein Asyl für Alkoholiker!“
Erst als ich ihr den doppelten Preis für eine Übernachtung auf den Tisch legte, gab sie ihm mit sichtbarem Widerwillen das schlechteste Zimmer im Haus. Dann hörten wir zwanzig Stunden lang nichts mehr von ihm.
Ich war eben von meiner Arbeit heimgekehrt und zog einen frischen Pullover über den Kopf, als es zaghaft an meiner Türe klopfte.
Ich öffnete und bat ihn in mein Zimmer.
„Ich weiß nicht, weshalb Sie das für mich taten, und möchte Ihnen danken. Die Wirtin sagte mir, mein Zimmer sei von Ihnen bezahlt worden. Offen gestanden, ich weiß nicht recht, wie ich überhaupt hierher gekommen bin. Darf ich mich Ihnen wenigstens vorstellen? Ich bin Michelangelo.“
Er war verlegen. Und ich war noch viel verlegener.
Er setzte sich auf den einzigen Stuhl im Zimmer, ich lehnte mich an die Bettkante.
„Gibt es hier vielleicht etwas zu trinken?“
Ich holte ihm eine Tasse Kaffee. Als ich aus der Küche zurückkam, stand er beim Fenster, die Hände auf dem Rücken verschränkt.
„Mein Leben ist total verpfuscht. Deshalb trinke ich. Ich habe keine Familie, kein Heim, keine Freunde, nichts. Nur Alkohol. Der läßt mich wenigstens alle meine vierunddreißig beschissenen Jahre vergessen. Ich mag nicht zu vorgeschriebenen Arbeitsstunden arbeiten. Ich mag auch nicht zu vorgeschriebenen Zeiten essen. Lieber, wenn ich Hunger habe. Ich trinke auch lieber, wenn ich Durst habe – aber Durst habe ich eigentlich immer“, fügte er ehrlich hinzu.
„Wo wohnen Sie?“ Ich fragte es aus Verlegenheit, um das Gespräch in Gang zu halten.
„Eh, mal da, mal dort. Im Sommer schlafe ich in einem leeren Güterwagen. Oder ganz einfach unter einem Baum in der Nähe der Acquaverde-Mündung. Im Winter ist es schlimmer. Bis um Mitternacht ist der Wartsaal im Bahnhof von Locarno geöffnet. Dort ist es schön warm. Aber nachher … Es gibt bei der Post geheizte Telefonkabinen. Aber sie sind entsetzlich klein. Doch irgendwie geht es immer.“
Es entstand wiederum eine Pause. Dann fuhr er fort:
„Am liebsten möchte ich an einem ganz einsamen Ort leben. Irgendwo in einer abgelegenen Hütte auf irgend einem Berg. Ich mag die Leute nicht mehr und die Hast nicht mehr und all den Gestank nicht mehr.“ Wir sprachen noch ein Weilchen miteinander. Er machte einen recht vernünftigen, nur etwas schwermütigen Eindruck.
Ich konnte es nicht unterlassen, ihn zu ermahnen, weniger zu trinken. Dann ging er hinaus in die Nacht.
„Du hast offenbar Michelangelos rettenden Engel gespielt“, sagte Marco anderntags zu mir. „Schade um den Kerl. Er wäre ein guter Arbeiter, wenn es keinen Grappa und wenig Wein für ihn gäbe. Er kann alles: mauern, Regentraufen setzen, sanitäre Installationen machen, malen, autofahren. Eine Zeitlang hat er bei mir gearbeitet – aber nur für fünf Franken in der Stunde.“
Es dauerte ein paar Tage, bis sich in meinem Hirn die beiden Sätze zusammenfügten: Michelangelos Bemerkung über seinen Wunschtraum vom einsamen Leben und Marcos Hinweis auf seine Kenntnisse. War er der starke Arm, den ich für den Monte Valdo brauchte? Aber er war verschwunden. Ich fragte seine Trinkkumpane in San Michele – niemand hatte ihn seit jenem Abend gesehen. Er war wie vom Erdboden verschluckt. Es wurde November. Das Acquaverde-Tal hatte sein leuchtendes Herbstgewand abgelegt. Die Birkenstämme schimmerten weiß aus den dunkeln Tannen und den Lärchen, die wie gelbe Flammen dem Flußufer entlang und in den Wäldern standen. Dann, gegen Weihnachten, senkte sich eine dicke Schneedecke über Froda. Die Mauern der Häuser waren auf einmal nicht mehr nur grau. Das Weiß des Schnees unterstrich ihre grünen Flechten. Die Kirche hatte einen Rosaschimmer.
Unsere Arbeit auf dem Bauplatz mußte eingestellt werden. Ich wechselte meine Stelle und wurde auf Marcos Empfehlung von Silvio, dem Elektriker, als Volontärin angenommen.
Und eines Abends fuhr ich bei dichtem Schneegestöber nach Locarno. Im Wartsaal des Bahnhofs fand ich Michelangelo. Er lag auf einer Bank und schnarchte. Sein Gesicht war gerötet. Natürlich war er wieder voll.
Nur mit Mühe gelang es mir, ihn aufzuwecken.
„Weiß schon“, murmelte er. „Gehe sofort. Aber in der Telefonkabine schmerzen mich die Knie.“
Er setzte sich benommen auf, schüttelte den Kopf, öffnete die Augen.
„Ach, Sie sind das? Lassen Sie mich in Ruhe!“
Er legte sich wieder auf die Bank, kehrte mir den Rücken zu und schnarchte weiter. Es blieb mir nichts anderes übrig, als ihm einen Zettel in die Tasche zu schieben:
„Wenn Sie immer noch Lust haben, an einem ganz einsamen Ort zu leben und zu arbeiten, dann rufen Sie mich bitte an. Telefonnummer 38924. Caterina Rüegg.“
Mehr konnte ich nicht tun.
Es war April, als er mich eines Abends aufsuchte. Er sei jetzt da, sagte er, und wolle morgen mit seiner Arbeit beginnen. Nichts, wo er bisher gewesen war, keine Frage, wo der einsame Ort sei; was er tun müsse. Einfach so.
Ich solle ihn morgen früh in San Michele abholen. Da hätte er all seine Sachen. Die wolle er gleich mitnehmen. Silvio gab mir einen freien Tag. Ich wollte meine Lehrzeit als Elektriker nicht vorzeitig abbrechen, sondern Michelangelo zunächst allein auf dem Monte Valdo hausen lassen.
Michelangelos Umzug
Zwei mit Kleidern vollgestopfte Jutesäcke, ein paar Plastikeimer verschiedener Farbe und Größe, eine mit einer zerfaserten Schnur zusammengebundene Matratze, ein sehr schmutziger Butangaskocher samt Bombe und ein fellbezogener Militärtornister waren Michelangelos ganze Habe. Dazu ein Paar Gummistiefel. Im einen steckte eine Rolle Klosettpapier, im Loch der Rolle eine Blockflöte. Im andern waren ein paar Kochlöffel und eine Käseraffel.
„Vorsichtig“, sagte Michelangelo, als ich die Stiefel packte, „untendrin sind drei Tazzini.“
Ich hätte mir ja denken können, daß er etwas Derartiges besaß. Tazzini, kleine Keramikschalen, sind ein Tessiner Allerwelts-Trinkgefäß. Zuerst benutzt man sie für den Wein, dann den Kaffee und schließlich den Grappa.
Mein Auto platzte beinah aus den Fugen, doch wir mußten noch unsere Einkäufe besorgen. Wir hatten am Vorabend eine lange Liste erstellt. Zwei Falci und zwei Kanister für Trinkwasser waren neben Lebensmitteln meiner Ansicht nach das wichtigste.
„Nein, eine Korbflasche Wein“, hatte mir Michelangelo widersprochen.
„Schau dir erst den Weg an, über den du deine Korbflasche tragen sollst. Für diesmal kaufen wir nur zwei Fiaschi.“ (Mit Stroh umhüllte Zweiliterflaschen.) Dann brauchten wir Kerzen, Streichhölzer, Wolldecken, einen Besen, eine Schaufel und den größten Gerlo, den wir finden konnten. Wir banden ihn auf dem Autodach fest. Dieser Tessiner Tragkorb ist etwas enorm Praktisches. Er hat kaum Eigengewicht, aber eine halbe Haushaltung läßt sich bequem darin verstauen. Und auf dem Rücken trägt sich alles viel leichter.
Unser Weg zum Monte Valdo war diesmal noch mühsamer. Der nun belaubte Wald war teilweise so dicht, daß der Weg einem Dschungelpfad glich. Überall sproßte frisches Grün.
Wir gingen am Speicher der inzwischen fertiggestellten Wasserleitung der Gemeinde vorbei. Sobald die schriftliche Bewilligung eintraf, würden wir hier mit unserm Graben beginnen.
Als wir uns durch die Brombeerranken kämpften, bemerkte Michelangelo: „Du hattest recht wegen der Falci und der Korbflasche.“
Schließlich standen wir vor den Häusern. Jetzt war alles noch viel schöner. Die Wiese war grün, der Apfelbaum blühte, Bienen summten, tausend Vögel zwitscherten. Ein offenbar zu früh erwachter Kuckuck rief „Cacacù“. Er stotterte.
Michelangelo riß die Augen auf und jauchzte: „Hier eröffnen wir den schönsten Grotto des Tessins!“
Er bezog das Haus mit der Jahrzahl. Im Dachstock würde er schlafen. Der ebenerdige Wohnraum mit dem Kamin sollte als Küche, Eß- und Wohnzimmer dienen. Im untern Haus wollte ich im Heuboden mein Schlafzimmer einrichten, und im dortigen Wohnraum würden wir mit den Instandstellungsarbeiten beginnen, sobald es regnete.
Im langen Haus bestimmten wir einen Raum als Magazin. Der Stall wurde vorläufig Holzlager.
Wir setzten uns auf der Stalltreppe in die Sonne, aßen Salami und Käse und tranken aus Michelangelos Tazzini den Wein. Dabei erstellten wir eine Liste der allerdringlichsten Arbeiten:
• Alle Häuser putzen
• Gabinetto bauen
• Regentraufen richten, damit die Zisterne wieder vollfließt
• Garten roden
• Im Wohnzimmer der „Casa Caterina“ Verputz abschlagen
Michelangelo sagte zu all dem nur ein einziges Wort:
„Farèm!“ Das heißt, schlicht und zuversichtlich: „Machen wir!“
Am Himmel zogen drohende Wolken auf. Ich entschloß mich zur Rückkehr nach Froda. Michelangelo begleitete mich bis zum Wagen, um die letzten Sachen nach unten zu tragen. Er war bedrückt.
„Bringst du mir übermorgen eine Flasche Grappa mit?“, fragte er. „Weißt du, so ganz einfach ist es doch nicht, hier allein im Dschungel zu bleiben und den Robinson zu spielen.“
Als ich wegfuhr, sah ich im Rückspiegel, wie er sich mit dem Ärmel über die Augen wischte. Armer, einsamer Robinson!
Fräulein Susi Stäubli
Michelangelos traurige Augen verfolgten mich. Es mußte schlimm sein, so plötzlich ganz allein in einer Einöde zu hausen. Aber war es richtig, ihm als Trost eine Flasche Schnaps zu bringen? Etwas Lebendiges wäre doch gescheiter.
Während ich in Froda am Fenster saß und über dieses Problem nachdachte, hüpfte Susi Stäubli auf meinen Schoß und schmiegte sich schnurrend in meinen Arm.
„Fräulein Susi Stäubli“ – so hieß meine Katze. Ich hatte sie zu Weihnachten, als sie sozusagen ein Teenager war, von Maria geschenkt bekommen. Im Februar hatte ich sie in einem Brief an meine Freundin Helen wie folgt beschrieben:
„Den Vornamen Susi habe ich gewählt, weil diese zwei Silben sich in ganz verschiedener Weise formen lassen: Wenn ich Suuusiii rufe, weiß sie, daß sie heimkommen soll. (Ob sie dann auch kommt, ist eine andere Frage.)
Sssusssi hört sie nicht gern. Das heißt nämlich, daß sie wieder was Dummes angestellt hat.
Der Name Stäubli ergab sich von selbst. Susis Fell hat die gleiche Farbe wie die Staubflöckchen, die einer unordentlichen Hausfrau wie mir beim jährlichen Frühlingsputz unterm Bett entgegenschweben. Oben sind sie mausgrau, unten etwas heller, mehr gegen Beige. Und Susi ist genau so.
Susi ist eine ganz spezielle Katze. Ich behaupte das, weil Susi sprechen kann.
„Meee“ heißt: „Steh endlich auf und laß mich raus.“
„Ich habe Hunger“, verkündet sie mit „miih.“
„Knknk“, warnt sie das Meislein am Futterhäuschen.
„Warum hast du so dumme Flügel, daß ich dich nie erwische?“ Sie preßt sich flach an den Boden. Ihr Schwanz zuckt wild hin und her. „Knknknk.“
„Witt, witt“, neckt das Vögelchen. Dann fliegt es weg.
„Mau“, murrt Susi enttäuscht, geht zum Rosenbusch und kauert sich zu einem Bällchen zusammen. Jetzt widmet sie sich mit gespitzten Ohren der Beobachtung eines Mäuselochs. Diese Arbeit ist rentabler. Zum Glück fliegen Mäuse nicht.
Mit einem stolzen „Brrrmmm“ legt Susi eine Maus vor meine Füße. Sie tut das fast jeden Tag, manchmal sogar am Sonntag. „Schau mal“, heißt das, „bin ich nicht eine fleißige Katze?“
„Pfch – geh sofort von meiner Maus weg!“, faucht sie den Hudelhund an, der ihre Beute beschnuppern will.
„Wo hast du denn das Mäuschen her?“, frage ich Susi. Es gibt zwar in der Katzensprache weder ein Wort, das „Stall“ bedeutet, noch eines für „Keller“. Susi kann mir aber trotzdem antworten. Ich muß nur an ihrem Fell riechen. Wenn es nach Heu duftet, war die Maus im Stall zu finden. War sie aber im Keller, so hat die ganze Katze einen modrigen Geruch. Dann wäscht sie sich stets besonders eifrig.
Und wenn sie mit dem Pfötchen bis hinters Ohr fährt, weiß ich auch noch, daß es morgen schneien wird. Ist Susi nicht eine ganz besondere Katze?
Letzte Nacht hat sie mich aber überrascht wie noch nie: Wir erwachten ob einem fürchterlichen Kreischen. Sämtliche Kater des Dorfes schienen sich ausgerechnet vor meinem Fenster in eine Schlägerei verwickelt zu haben.
„Februar“, erklärte ich Susi. „Aber du bist noch zu jung, um das zu verstehen.
Susi sprang auf den Sims und schaute interessiert in den mondbeschienenen Hof. Ihre Gestalt hob sich wie ein Scherenschnitt vom Fenster ab.
Zuerst kauerte sie geduckt, wie vor einem Mauseloch, dann stand sie auf, hielt auf langem Hals den Kopf nach vorn, ihn aufmerksam nach rechts und links drehend, gleich einem Zuschauer beim Tennismatch. Dann aber streckte sie mit eingeknickten Vorderbeinen ihr Hinterteilchen in die Höhe. Ihr Schwanz war wie ein in die Luft gestelltes Ausrufzeichen.
„Mrrraaaooo“, rief sie vorwurfsvoll hinaus.
„Geht weg“, sollte das wahrscheinlich heißen. „Ihr stört uns. Wir wollen Ruhe haben.“
„Mrrraaaooo!“ Diesmal schrie sie es laut und fordernd.
Ihre Vorderbeine stampften in zornigem Rhythmus.
„Laß nur“, tröstete ich Susi, „die gehen dann schon wieder. Komm jetzt schlafen.“
Ich weiß nicht, wie lange der Lärm dauerte. Aber schließlich hörte er auf.
Zögernd hüpfte Susi vom Sims und legte sich neben mich auf die Bettdecke.
„Mrrrh, rrrmmm.“ Sie schnurrte wie ein Nähmaschinchen und hielt mir abwechslungsweise Bauch und Rücken hin, damit ich sie streichle. So zärtlichkeitsbedürftig war Susi noch nie gewesen.
Und dann begann sie plötzlich zu sprechen. Nicht in der Katzensprache. In gutem Deutsch. Weiß der Himmel, wo sie das gelernt hat. Ganz deutlich sagte sie zu mir: „Tust du nur so, weil du keine kleinen Kätzchen in unserm Hause willst, oder verstehst du wirklich nicht, daß ich raus zu dem dicken, weißen Kater möchte?“
Aber vielleicht habe ich da schon geschlafen.
Nun ja, Susi entwischte mir doch. Drei Tage lang suchte ich sie zum Gaudium von ganz Froda. Dann erschien sie eines Morgens wieder, als ob nichts geschehen wäre. Und jetzt, Mitte April, wurde sie zusehends rundlicher. Sie hatte offenbar den weißen Kater angetroffen.
Michelangelo war ihr sympathisch. Das hatte ich bei seinem kürzlichen Besuch gesehen.
Für meine nächste Monte-Valdo-Reise übers Wochenende kaufte ich einen Liegestuhl, einen Schlafsack, ein paar fehlende Küchengeräte, zwei Büchschen Katzenfutter und ein paar Fiaschi Wein.
Carletto, der ehemalige Fußballstar (FC Locarno, Nationalliga A, 1936 bis 1939!), lieh mir sein aus Weidenruten geflochtenes Trainingskörbchen. Darin hielt Susi Stäubli Einzug auf dem Monte Valdo.
Michelangelos Gesicht war unbeschreiblich.
„Hier ist dein Grappa“, sagte ich und drückte ihm das Körbchen in die Hand. Er öffnete es.
„Capisi pü nagott – jetzt versteh‘ ich nichts mehr – verspricht sie mir Grappa und bringt statt dessen eine Katze!“
Er schüttelte den Kopf.
Susi ist wirklich eine gescheite Katze. Sie umschmeichelte Michelangelos Beine. Als er sie aufhob, leckte sie ihm die Hand. Er streichelte sie, und sie schnurrte selig.
„Glaubst du nicht, daß Susi dir besser Gesellschaft leisten kann als eine Flasche Schnaps?“
Er antwortete nicht. Aber seine Hand fuhr weiter über Susis Fell.
Die Ureinwohner melden sich
Michelangelo zeigte mir seine Arbeiten.
Der Dachstock seines Hauses war gewischt und gefegt. Die Matratze lag ordentlich bezogen in einem der Betten. Seine beiden Kleidersäcke hingen an zwei rostigen Nägeln an einem Tragbalken des Daches.
Im Wohnraum hatte er eine Art Küchenkombination gebastelt. Der Kocher stand auf zwei mit einem Brett verbundenen Böcken am sauber geputzten Fenster. Links davon hatte er aus Kastanienästen ein Gestell für sämtliche Küchengeräte zusammengefügt. Die Lebensmittel konnten wir in einem eingebauten Schränkchen unterbringen.
Während ich Michelangelos Werk betrachtete, sah ich an der Decke ein graues Tierchen krabbeln, etwa dreimal so groß wie eine Maus. Sein Fell war silbergrau. Es hatte schwarze Äuglein und einen schönen buschigen Schwanz, fast wie ein Eichhörnchen.
„Ein Ghiro – Siebenschläfer –, er ist schon fast zahm. Aber wenn man ihn streicheln will, beißt er“, erklärte mir Michelangelo.
Arbeit für Susi, dachte ich.
„Und nun schau dir dein Schlafzimmer an!“ Michelangelo ging voran, stolz wie ein Führer von Versailles. Er hatte den Heuboden ausgeräumt. Dicke Kastanienbretter waren zum Vorschein gekommen.
„Ich hätte diesen Fußboden gerne noch gewichst“, sagte Michelangelo trocken, „aber ich fand den Stecker für die Bohnermaschine nicht.“
Der Raum war in seiner ganzen Primitivität eindrucksvoll. Der Dachgiebel stieg in der Mitte etwa viereinhalb Meter hoch. Die jetzt von Spinnweben und Heustaub befreiten Balken waren aus Eichenholz. Die Querleisten aus in der Mitte gespaltenen Kastanienstämmen trugen die regelmäßig geschichteten Steinplatten. Zwischen den Platten glitzerte die Sonne und warf kleine Strahlenbündel schräg durchs Zimmer. Durch die große Dachluke sah ich auf eine Eiche, an der die Reben bis in den Raum hinein rankten. Fenster waren natürlich keine da.
„Schau, das habe ich zwischen den Platten deines Daches gefunden!“ Michelangelo hielt mit spitzen Fingern ein etwa achtzig Zentimeter langes, durchsichtiges Band in die Höhe.
Eine Schlangenhaut! Auf dem Dach über mir krochen also Schlangen herum. Mich fror plötzlich. Mein erster Gedanke war, sofort wieder nach Froda zurückzukehren. Wenn ich hier im Bett lag, eine baumelnde Schlange über mir!
Ich brauchte einige Sekunden, um mich zu fassen, und gab mir Mühe, Michelangelo meinen Schrecken nicht zu deutlich zu zeigen. Wenn ich so ein Jammerlappen war, war es besser, meine Pläne zu begraben und in die Stadt zurückzukehren.
„Dai – ach geh“, sagte ich also wegwerfend, „hier gibt es keine Giftschlangen, nur Nattern.“
„Ich fürchte mich aber vor allen Schlangen“, gestand mir mein starker Helfer. „Ich bin mal von einer Viper gebissen worden. Das genügt.“
„Dir zuliebe werde ich eine Ampulle Serum kaufen.“
Schon zeitig zog ich mich in mein luftiges Zimmer zurück, schlüpfte in den Schlafsack und legte mich auf meinen Liegestuhl. Bei jeder kleinsten Bewegung knarrte das in einen Metallrahmen gespannte Segeltuch zum Gotterbarmen. Ich schlief schlecht, träumte von Schlangen, die über mir schaukelten, und von krabbelnden Siebenschläfern.
Dösend bemerkte ich, daß Susi vom Bett sprang. Dann hörte ich einen erschreckten Pieps. Also gab es auch Mäuse. Etwas Weiches, Pelziges zwängte sich in meinen Schlafsack und kroch bis zu den Füßen. Ich glaubte, es sei Susi.
Anderntags, beim Aufräumen, kollerte die Leiche eines Siebenschläfers aus dem Sack. Er hatte vor Schreck über Susi nach seiner Flucht in meinen Schlafsack offenbar einen Herzschlag erlitten. Mein Schreck über ihn war auch nicht gering, aber mein Herz war zum Glück ein bißchen robuster.
Gegen Sonntagabend rüstete ich mich wieder zur Heimkehr nach Froda. Michelangelo begleitete mich. Wir hatten jetzt unser Trinkwasserproblem provisorisch gelöst. Etwa zwei Kilometer talwärts plätscherte am Straßenrand ein Brunnen. Wir fuhren bis dorthin, füllten die beiden Zehnliterkannen.
Ich kehrte mit meinem Auto nochmals zurück zum Parkplatz. Von dort trug Michelangelo die Kannen im Gerlo nach unten.
Michelangelo wollte den Weg durch den Wald nur noch mit einem Stock bewaffnet gehen. Wegen der Schlangen.
„Schau, da ist eine Smaragdeidechse“, sagte er, als wir, Monte Valdo verlassend, um die Ecke des langen Hauses bogen. Der grasgrüne Reptilkopf erhob sich am Rande eines Mäuerchens. Ob ich die Schlange bannte oder sie mich? Ich weiß es nicht. Wir waren beide regungslos und schauten einander an. Michelangelo hatte noch nicht bemerkt, daß die vermeintliche Smaragdeidechse eine Schlange war.
„Komm schon“, rief er mir zu und machte mit seinem Stock eine Bewegung. Die Schlange zuckte erschreckt und floh abwärts. Ihr grüner Leib quoll förmlich aus dem Mauerloch. Ein Meter, immer noch mehr. Sie war gegen anderthalb Meter lang.
„Una biscia, una vera biscia! Eine Natter, eine richtige Natter – töte sie, Dio mio, töte sie!“ Michelangelo war völlig außer sich.
„Nein, Nattern sind nicht giftig. Laß sie.“
„Alle Schlangen sind giftig, mir graut vor ihnen, so bring sie doch endlich um!“
„Wenn du sie töten willst, dann tu‘s gefälligst selbst. Du hast schließlich einen Stock, ich bloß eine Einkaufstasche.“
Mit zitternden Händen und ohne richtig zu zielen, schlug er gegen die Schlange, die sich weiter abwärtskriechend im dürren Laub verlor. Ich war froh, daß Michelangelo sie nicht erwischt hatte.
Meine erste Begegnung mit einer freilebenden Schlange hatte mir gezeigt, daß diese Tiere gar nicht so unsympathisch sind. Nur – ums Haus herum oder gar über dem Bett baumelnd gefielen sie mir nicht besonders.
So holte ich mir Rat bei Guido.
„Schaffe dir wieder einen Hund an, oder sogar zwei. Dann hast du Ruhe. Schlangen meiden Orte, wo sich zu vieles bewegt und Lärm macht.“
Wenn es eine so angenehme Lösung gab …
Hudel, mein Collie, war vor kurzem an einem Herzschlag gestorben. Ganz Froda trauerte mit mir. Nie mehr wollte ich einen Hund. Die grüne Schlange war dann schuld, daß ich meinen Entscheid widerrief und die Monte-Valdo-Familie durch zwei Hunde vergrößert wurde.
Maiskorn und Kaffeebohne
Radio Monte Ceneri bringt jede Woche eine Sendung für Tierfreunde. Darin werden entflogene Kanarienvögel und Wellensittiche, entlaufene Hunde und Katzen mit Steckbriefen und den Telefonnummern ihrer verzweifelten Besitzer gemeldet. Wer irgendein Haustier möchte oder zu verschenken hat, kann dies ebenfalls verkünden lassen.
Michelangelo war eifriger Radiohörer und schleppte den kleinen Transistor überall mit sich herum. Er gab mir die Telefonnummer von jemandem, der für zwei junge Jagdhunde ohne Stammbaum ein Plätzchen suchte. Die Nummer kam mir irgendwie bekannt vor. Ich stellte sie ein. Es war Marco! Ich erklärte ihm mein Anliegen.
„Das hätten wir weiß Gott ohne Vermittlung des Radios machen können. Aber komm und schau dir die beiden Kerlchen an.“
Es war allgemeine Liebe auf den ersten Blick. Die Welpen mochten etwa zehn Wochen alt sein. Das Weibchen war schwarz. Es hatte über jedem Auge einen verschmitzten braunen Punkt und mitten in seiner braunen Brust ein weißes Fleckchen. Ein Krawättchen sozusagen. Seine aufmerksamen Augen hatten einen pfiffigen Ausdruck.
Brust, Pfoten und das Schwanzspitzchen des rotbraunen Männchens waren weiß. Sein Gesicht mit den langen Schlappohren runzelte sich bereits sorgenvoll.
Die erste Reise bekam ihnen schlecht. Sie erbrachen mindestens das, was sie in den drei letzten Tagen gefressen hatten. Ich hatte weder eine Leine noch irgend eine Schnur bei mir. Sie folgten mir trotzdem brav durch den Wald, vorsichtig die stachligen Kastanienschalen vermeidend.
Das Weibchen sprang sofort an Michelangelo hoch. Sein Bruder war sehr zurückhaltend und versteckte sich ängstlich hinter mir.
Als erstes mußten sie Bekanntschaft mit Susi Stäubli machen. Susi tat das auf ihre Art. Sie machte einen Buckel, fauchte die beiden an und gab jedem eine tüchtige Ohrfeige. Damit war ein für allemal festgestellt, wer hier regierte.
Wie sollten sie nun heißen?
„Das Weibchen schaut aus wie ein verbrannter Chicco di caffè“, fand ich:
„Wie sagt man Chicco di caffè auf deutsch?“, erkundigte sich Michelangelo.
„Kaffeebohne.“
„Dann hab‘ ich‘s schon. Wir nennen sie Bona. Tönt weiblich und enorm vornehm. Und kein Mensch ahnt, daß eine verbrannte Kaffeebohne Bonas Patin war.“
Er nahm das hiermit getaufte Böhnchen auf den Arm.
„Ciao Bona, du gefällst mir sehr.“
„Aber wenn sie ausschaut wie eine Kaffeebohne, dann ist er ein Maiskorn – ein Grano turco.“
Ich streichelte den maisfarbigen Hund.
„Ciao Grano, du wirst mein großer Liebling sein.“ Grano schaute ernst und scheinbar tief betrübt in die Welt. Bona hüpfte vergnügt um uns herum. Da bemerkte ich, daß Grano schielte. Wenn er sein Gesicht geradeaus gegen den Monte Ceneri richtete, schaute sein linkes Auge nach Bellinzona. Nun wußte ich wenigstens den Grund seiner Sorgen.
Bald hatten sie den Schock der Autofahrt überwunden und begannen miteinander zu spielen, stets einen sorgfältigen Bogen um Susi machend, die auf dem Spaltklotz saß und sie nicht aus den Augen ließ.
„Nun sind wir schon vier ständige Einwohner auf dem Monte Valdo.“ Michelangelo zählte auf: „Das Susi, die Bona, der Grano und der Michelangelo. In vierzehn Tagen, wenn sie ganz zu uns zieht, wird die Caterina die fünfte sein.“
Ich war aber die sechste, denn in der Zwischenzeit gebar Susi einen Sohn. Wir nannten ihn Bimbo.