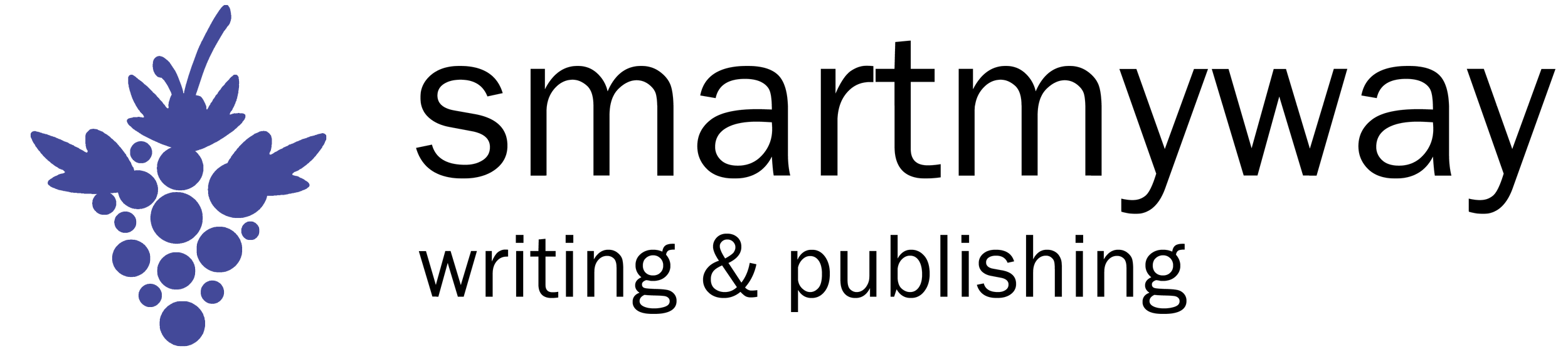Sie bezahlen, was Sie wollen.
Auf dieser Seite können Sie das Buch Kleine Welt im Tessin kostenlos lesen. In jener Schreibe, wie es die Autorin 1974 verfasst hatte. Wir veröffentlichen zum Start jede Woche ein neues Kapitel. Sie entscheiden, wie Sie die weitere Verlagsarbeit von smartmyway unterstützen möchten. Sie haben die Wahl:
Sie lesen das Buch kostenlos, freuen sich daran und empfehlen uns weiter.
Sie lesen das Buch kostenlos und tragen sich in unserer Leserliste ein, damit wir Sie über unsere Aktivitäten informieren können.
Sie lesen das Buch und spenden uns einen Betrag, den Sie für angemessen halten.
Sie lesen das Buch, indem sie es bei Amazon oder bei uns im Verlag für sich selbst oder zum Verschenken kaufen.
Mit herzlichen Tessiner Grüssen!
Roland Voser & Maurizio Vogrig
Verleger smartmyway
Cademario im Frühling 2025
Vielen Dank, dass Sie uns unterstützen!
Ich möchte freiwillig etwas bezahlen.
Wir freuen uns über jeden Betrag, mit dem Sie unsere Arbeit unterstützen möchten.
Hier ist der Einzahlungsschein für Ihre Spende für die Kleine Welt im Tessin.
Schreiben Sie uns bitte, damit wir uns bei Ihnen bedanken können. Herzlichen Dank!
Ich möchte das Buch in klassischer Form lesen.
Wir freuen uns über Ihren Kauf bei Amazon. Innerhalb der Schweiz liefern wir auch direkt vom Verlag.
Die Tessiner Tagebücher von Kathrin Rüegg.
In den letzten 5 Jahren hat der Schweizer Verlag smartmyway in vielen unentgeltlichen Stunden Kathrin Rüeggs Bücher neu aufgelegt, weil die lebensbejahenden Geschichten dieser bemerkenswerten Unternehmerin aktueller denn je sind und ein neues Publikum erreichen sollen.
Der Verlag präsentiert 2025 dieses ideelle Projekt erstmals komplett mit den neun Tessiner Tagebüchern in Taschenbuchform als Einzelbände und in drei Sammelbänden, sowie den zwei dazu gehörenden Bildbänden. Sogar eine englische Version gibt es jetzt vom ersten Band.
Kleine Welt im Tessin von Kathrin Rüegg.
Erstes Tessiner Tagebuch.
Ein Lesebuch von smartmyway.
Kapitel 3.
MAI
Mein Einzug in den Dschungel
Mein Koffer war gepackt. Zum Abschluß wusch ich meine Haare und duschte so lange, bis der Boiler in Marias Badezimmer leer war. Eine Dusche würde ich vermissen. Aber hoffentlich nicht für lange.
Meine Post war nach Sassariente, postlagernd, umadressiert. Ich hatte allen meinen Freunden geschrieben, daß ich jeweils am Dienstag und Freitag ihre Briefe abholen werde. Ich wollte mich so einrichten, daß ich die übrigen fünf Tage der Woche nicht vom Monte Valdo weg mußte.
Einen schönen Tag hatte ich für meinen Umzug nicht ausgesucht. Es regnete. Es kann nur im Tessin so regnen. Wer es noch nie erlebt hat, stellt sich am besten vor, wie Sankt Petrus und alle Engelchen eine riesengroße Gießkanne mit Brause über das Tessin, den Lieblingsgarten des lieben Gottes, halten. Der Regen tropft nicht mehr, er rinnt in Fäden vom Himmel.
Auf Michelangelos Rat hatte ich mir einen wasserdichten Umhang gekauft, wie ihn die Straßenarbeiter tragen. Dazu einen Hut aus dem gleichen Material und die höchsten Gummistiefel. Wenn meine ehemaligen Angestellten mich so sehen könnten!
Ich patschte durch den Wald, beladen mit einem Rucksack und drei an einen Stock gehängten Einkaufstaschen. Über die ganze Last spannte ich meinen mächtigen roten Tessiner Schirm.
Michelangelo hatte mir zum Empfang eine Art Triumphbogen gebastelt. Mühsam eingesteckte Blümlein, an denen Regentropfen herunterkollerten, hingen daran. Sein Willkommensgeschenk war ein Eßtisch. Kopfund Fußteil des einen Bettes waren irgendwie zusammengefügt und bildeten das Tischblatt. Aus den wenigen noch guten Bodenbrettern des obern Heustalls hatte er zwei gekreuzte Beine und einen Quersteg geschreinert.
Anstelle von Stühlen standen rings um den Tisch die Stücke eines Baumstamms, auf die entsprechende Sitzhöhe zugeschnitten. Im Kamin prasselte ein freundliches Feuer. Die Hunde saßen davor und wärmten sich. Susi säugte in einer Kartonschachtel ihr Söhnchen und gab zärtliche Gurrlaute von sich.
Weshalb Michelangelos Bett wohl in der Küche stand? Überhaupt – er schien mir wieder einmal bedrückt.
„Schau dir das an“, jammerte er. Er führte mich in sein Schlafzimmer unterm Dach. Der Fußboden war an vielen Stellen naß.
„Und in deinem Zimmer schaut es nicht viel besser aus. Und im Stall wird das Holz naß, und im Lagerraum baden die Werkzeuge.“
Die Dächer waren nicht mehr dicht!
„Wenn es so hereinregnet, dann wird alles morsch. Zuerst die Tragbalken. Dann die Fußböden. Dann krachen die Dächer zusammen, und bald besteht unser ganzes Dorf nur noch aus Ruinen. Da, schau, dieser Balken ist morsch, dieses Brett ist morsch.“
Marcio – morsch – wie ich dieses Wort haßte!
„Du lieber Gott, was tun wir da? Kennst du niemanden, der Steindächer reparieren kann?“ Ich wußte von meiner Arbeit bei Marco, daß dies eine ganz spezielle Kunst ist, für die es nur noch wenige Spezialisten gibt.
„Doch, ich kenne einen. Das Dumme ist, daß ich mich nicht mehr erinnern kann, wie er heißt.“
Michelangelo war den ganzen Tag nicht bei der Sache. Er suchte in sämtlichen Schubladen seines Hirns nach dem Namen dieses Mannes. Beim Nachtessen sagte er plötzlich: „Ich hab‘s: Ugo Bisi.“
So würde ich morgen wieder ins Tal fahren und nach Ugo forschen.
Ich füllte meine Wärmflasche mit dem Regenwasser, das Michelangelo dank all seinen draußen aufgestellten Eimern heute reichlich zur Verfügung hatte, und trug Susi mit Sohn in ihrer Schachtel in mein Zimmer. Es regnete nicht mehr. Ich spannte aber sicherheitshalber meinen roten Schirm über das Katzenwochenbett. Wenigstens die beiden sollten nicht naß werden.
Ugo der Weise
Ich fand Ugo nach ein paar Telefonaten. Umständlich erklärte ich ihm den Weg.
„Ach, Sie meinen den Monte Valdo?“, unterbrach er mich. „Den kenne ich gut. Ich war als Kind immer dort, um bei der Weinlese zu helfen. Ich komme.“
„Und wann kommen Sie?“
„Am ersten Regentag. Dann sehe ich die Schäden besser.“
Am andern Tag schon goß es, und Ugo erschien. Ein weiterer typischer Tessiner mit krausem Haar und eckigen Gesichtszügen. Sein Alter war schwer zu schätzen. Es mochte zwischen fünfundvierzig und fünfundfünfzig Jahren liegen. Er hatte langsame, bedächtige Bewegungen, sprach ebenso, die Augen stets auf den Boden gerichtet.
Ugo inspizierte jede einzelne Steinplatte der vier Dächer und kontrollierte auch die Tragbalken. In Michelangelos Haus war einer bedenklich morsch. Was machen wir da?
Er maß die Länge, nahm Axt und Säge, ging in den Wald, fällte einen Kastanienstamm und setzte ihn ein.
So einfach war das.
„Das ist aber nur provisorisch, allerdings hält es die nächsten zwanzig Jahre aus.“
Ugo sah jede einzelne undichte Stelle nach, verschob hie und da eine Platte. Am Abend, als der Regen wieder in Strömen floß, saßen wir im Trockenen.
Michelangelo entfachte das Feuer, wir schmolzen an Ästchen aufgespießten Formagellakäse und tranken Wein dazu. Ein ganz privates Fest zur Feier der dichten Dächer.
Das war der Moment, um Ugo nach den alten Zeiten auf dem Monte Valdo zu fragen.
Hier lebte während der Sommermonate ein Bauer namens Delio. Er besaß auch in Sassariente ein Gut, zog aber jeweils im Frühsommer mit seinem ganzen Vieh herauf, pflegte den Weinberg, den Kartoffelacker und einen Gemüsegarten.
„Und wie war das denn mit dem Weg?“ Diese Frage beschäftigte Michelangelo schon lange.
„Von Sassariente aus führte ein gut ausgebauter Fußweg hierher.“ Wahrscheinlich war er heute zugewachsen. Man müßte ihn im Winter wieder freischlagen. Aufwärts brauchte man vierzig Minuten, abwärts eine Viertelstunde.
„Soo weit weg von der Zivilisation sind wir eigentlich gar nicht“, sagte Michelangelo fast enttäuscht.
„Robinson hatte es doch schwieriger.“
„Und das Wasser?“
„Zu meiner Zeit war der Brunnen schon versiegt. Es gab einen Pfad ins Valle della Colera. Dorthin trieb Delio das Vieh zur Tränke, wenn es sehr trocken war. Sonst genügte das Wasser der Zisterne. In den Krisenjahren wanderte Delio aus nach Kalifornien.“
„Und der Monte Valdo schlief mit seiner Abreise ein“, beendete Michelangelo die Geschichte.
Ugo ging erst heim, als es schon dunkel war. Mir schien, er wäre gern bei uns geblieben.
„Schafft euch den größtmöglichen Wasservorrat in der Zisterne an“, hatte er uns vor dem Weggehen noch geraten.
„Es kann hier verdammt heiß werden und wochenlang nicht regnen.“
Wir beschlossen, die Zisterne zuerst einmal zu reinigen. Zu Michelangelos Leidwesen mußten wir das seit seiner Ankunft gesammelte Wasser auslaufen lassen. Als er aber auf dem Grund den schwarzen, etwa dreißig Zentimeter hohen Schlamm sah, war er getröstet. Er stieg mit einer Leiter in den Schacht und lachte über meinen Befehl, eine brennende Kerze mitzunehmen. Ich war besorgt, er könne durch Sauerstoffmangel ohnmächtig werden. Einer meiner eisernen Monte Valdo-Grundsätze war es, jeglicher irgendwie möglichen Unfallgefahr aus dem Weg zu gehen.
Zum Schluß seiner Aktion schrubbte er die Wände mit Vim ab und spülte mit dem in den verschiedenen Eimern aufgesparten Wasser nach.
Ich bat den strahlend blauen Himmel um Regen, denn jetzt mußten wir auch noch das Waschwasser vom Brunnen hertragen.
Heinis Désirées
Unterhalb der Häuser war die Erde rot.
„Dorthin müßt ihr Kartoffeln pflanzen. Die gedeihen nirgends besser.“ Natürlich stammte auch dieser Rat von Ugo. Die Sortenwahl machte mir Schwierigkeiten. Ugo konnte mir da nicht helfen. So fragte ich denn Heini, den Mann meiner Freundin Helen aus Basel. Er ist der begeistertste Hobbygärtner, den ich kenne. Zu Helens Leidwesen hat er sogar zwei Schrebergärten.
Bei meinem üblichen Postbesuch am Freitag fand ich ein Paket von Heini.
„Nimm Désirée“, schrieb er mir, „und rechne mit einem zehnfachen Ertrag. Weil diese Sorte im Tessin vielleicht nicht bekannt ist, schicke ich dir hier fünf Kilo. Mehr als fünfzig Kilo wirst du ja in einem Winter nicht essen.“
So rodeten wir denn ein Stück der roten Erde, das groß genug war, um Heinis Kartoffeln aufzunehmen. Wir taten etwas von dem uralten Mist vom Misthaufen dazu, genau wie es in meinem Gartenbuch stand. Weder Michelangelo noch ich hatten irgendwelche Erfahrungen in Landarbeiten.
„Die dümmsten Bauern weit und breit sind wir ganz sicher“, sagte Michelangelo. „Wenn das Sprichwort stimmt, dann müßten wir die größten Kartoffeln ernten.“
Aber um das zu erfahren, mußten wir bis Ende September warten. So stand es in meinem Gartenbuch.
Am nächsten Nachmittag wollten wir mit der Bohnensaat beginnen und Tomatensetzlinge einpflanzen.
Doch da kam der unheilvolle Brief.
Noch eine Hexe
Die Baubewilligung war immer noch nicht eingetroffen. Ich hatte deshalb vor kurzem wieder an die Gemeinde Sassariente geschrieben.
Der Antwortbrief, den ich an jenem Tag erhielt, machte all unsere Arbeitspläne zunichte.
„Wir erteilen Ihnen die Baubewilligung nur“, schrieben sie, „wenn Sie sich mit Ihrer Unterschrift damit einverstanden erklären, daß wir weder Kinder zur Schule befördern noch die Straße vom Schnee räumen, noch den Kehricht abholen, noch Sie mit Wasser versehen müssen.“
Wenn ich kein Trinkwasser bekam, fiel mein ganzes Feriensiedlungsprojekt wie ein Kartenhaus zusammen. Was nützte dann meine ganze Ausbildung? Was half mir dann Michelangelo? Mußte ich ihn wieder entlassen? Und wohin sollte ich mit Susi Stäubli, mit ihrem Kind, mit Grano und Bona? Wer würde die Désirée-Kartoffeln ausgraben und essen?
Michelangelo würde wieder herumlungern, sich betrinken und im Wartsaal übernachten. Auch die geflickten Dächer nützten nichts. Ich war dem Weinen nahe und sah beim Aufwärtsfahren die Straße nur durch einen trüben Schleier. Beim Brunnen füllte ich die Wasserkanister, von denen wir gehofft hatten, wir würden sie nur kurze Zeit brauchen. Dann riß ich mich zusammen. Jetzt suchen wir eben die Quelle!
Michelangelo wunderte sich über mein grimmiges Gesicht. Ich erklärte ihm, daß wir nur noch die dringendsten Arbeiten in den Häusern verrichten würden, daß der Garten nicht weiter bepflanzt werde. Wasser graben war wichtiger.
„Farèm“, sagte er nur.
Ich erinnerte mich, daß der von Silvia angegebene Ort in gerader Linie über den Häusern lag, etwas unter halb des Fußweges. Wir kämpften uns aufwärts durch den inzwischen mehr als mannshoch gewordenen Farn. Der Pfad, den wir anlegten und nachher so oft am Morgen voller Hoffnung und am Abend enttäuscht zurücklegten, war eine kleinere Klettertour. Auf halber Höhe war eine Terrasse, die eine unwahrscheinlich schöne Aussicht bis weit nach Italien bot, bis dort, wo der Lago Maggiore eine Windung nach Süden macht. Dann mußten wir drei Mauern erklimmen, die zur Terrassierung des Geländes gedient hatten. Die Kastanienbäume standen hier schon hoch, doch ganz früher mußte auch hier Weinberg gewesen sein.
Es machte uns viel Mühe, die von Silvia gesteckten Markierungen wieder zu finden. Die Äste hatten in der Zwischenzeit Wurzeln bekommen und ausgeschlagen. Ich war nicht ganz sicher, ob wir am richtigen Ort waren. So versuchte ich es eben auch: Ich schnitt einen Haselzweig so zurecht, wie ich es bei Silvia gesehen hatte, und ging mit den gleichen sorgfältigen Schritten quer zum Hang, die Rute mit angewinkelten Armen vor mich hinhaltend. Michelangelo schaute mit immer runder werdenden Augen zu. Da – wie von einem Magnet gezogen, senkte sich die Rutenspitze bei der ersten der vermutlichen Markierungen. Ich ging weiter. Bei jedem der vier Schößlinge geschah daßelbe.
„Cristo“, sagte Michelangelo ehrfürchtig, „und eine Hexe bist du auch noch.“
Pickel, Schaufeln, zwei Eimer und eine Flasche mit verdünntem Wein hatten wir bereits mitgenommen. Ich sandte ein kleines, flehentliches Stoßgebet zum Himmel und zum speziellen Schutzheiligen des Monte Valdo. Wenn ich schon Michelangelo und Ugo gefunden hatte, würde mir auch die Quelle nicht verborgen bleiben – sofern sie wirklich hier unten durchfloß …
JUNI
Das Quellchen
Es ist mühsam, einen Graben zu machen. Es ist noch viel mühsamer, dies im Wald zu tun. Der Boden war durchflochten mit Wurzeln aller Art. An der Oberfläche waren sie dünn und mit der Schaufel zu durchschneiden. Dann aber wurden sie dicker und zäher. Ich glaube, Hanfseile sind nicht viel mühseliger zu zertrennen.
Am Mittag war Michelangelos Grabenstück gut drei Meter lang und einen halben Meter tief, meines halb so lang und halb so tief.
„Das kommt, weil du nicht in die Hände spuckst“, erklärte mir der Fachmann. Er mußte es wissen.
Nach einer Tiefe von etwa siebzig Zentimetern hörten die Wurzeln auf. Wir gruben weiter in wunderschön schwarzer, tiefer unten roter Erde. Steine gab es nur wenige. Die beladenen Schaufeln flogen nur so. Unterhalb des Grabens häufte sich unser Aushub. Die Hunde schauten uns neugierig zu und jagten den hinabkollernden Steinchen nach.
Am Abend war unser Graben, der Balken des T, etwa sechs Meter lang und führte von der ersten bis zur vierten Markierung. Wir waren in einer Tiefe von gut einem Meter auf eine mit Lehm durchsetzte Sandschicht gestoßen. Sie war so hart, daß man mit Pickel und Stemmeisen jede Schaufel voll mühsam losschlagen mußte. Michelangelo hätte wahrscheinlich noch lange weiter gegraben. Um halb acht Uhr konnte ich aber einfach nicht mehr.
Wasser suchen ist etwas ungeheuer Spannendes. Mit jedem Pickelschlag denkt man: Noch zehn Zentimeter mehr, dann finden wir die Quelle. Noch zwanzig Schaufeln mehr, dann haben wir Wasser. Aber an diesem ersten Tag fanden wir es nicht. Ich schlief herrlich und träumte, wir hätten die Quelle ausgegraben.
Normalerweise stand ich auf, wenn ich den Cacacù, unsern stotternden Kuckuck, zum erstenmal rufen hörte. Am folgenden Morgen klapperten Michelangelos Zoccoli schon über die Treppen, als erst ein ganz feiner Lichtschimmer den Tagesanbruch ahnen ließ. Die Hunde jaulten und kratzten an meiner Tür. Es klopfte zaghaft.
„Bist du schon wach? Mir träumte, wir hätten Wasser gefunden.“
Ich sprang aus dem Bett. Wenn Michelangelo denselben Traum wie ich gehabt hatte, dann mußte er sich einfach erfüllen. Proviant nahmen wir gleich mit. Es war schade, die Arbeit wegen des Mittagessens zu unterbrechen. Susi ließ ihr Kind für ein Weilchen allein und begleitete uns auch, hie und da die Hunde mit einem kurzen Fauchen zurechtweisend.
Abends um halb fünf Uhr – unser Graben war in seiner ganzen Länge etwa anderthalb Meter tief – hielt mir Michelangelo einen faustgroßen Stein unter die Nase. Er war naß!
„Hurra, ein nasser Stein!“
Michelangelo hüpfte wie besessen im Graben hin und her und jauchzte. Dann küßte er den Stein und warf ihn hoch in die Luft. Ich hätte Michelangelo am liebsten umarmt.
Eifrig vertieften und erweiterten wir nun mit dem Stemmeisen die Stelle, wo der Stein gelegen hatte. Ein kleines Rinnsal sammelte sich. Michelangelo wollte die trübe Brühe mit der Hand ausschöpfen und trinken.
„Heute abend trinke ich nur von diesem Wasser, keinen Wein.“
Wir schaufelten unserm Quellchen einen schmalen Abfluß, den Mittelstrich des T. Wie schnell das jetzt ging, obwohl die Wurzeln immer noch zäh und die Lehmschicht genau gleich hart war.
Tiefsinnig stellte Michelangelo fest: „Wein muß man trinken, um besoffen zu werden. Beim Wasser genügt es schon, es zu finden.“
Auf dem Heimweg sang Michelangelo: „Ich bin dein Sturm, dein Regen und Wind …“
Es war das erste Mal, daß ich ihn singen hörte. Offenbar war er so glücklich wie ich.
Wir blieben lange auf und betrachteten den Sternenhimmel. Man sah die Milchstraße. Die Nacht war wie dunkelblauer Samt, auf dem Brillanten funkeln. Der Mond schien wie ein zur Bundesfeier aufgehängter Lampion. Die Grillen zirpten ihr fröhliches Lied, und Glühwürmchen ließen ihre freundlichen Lichtlein aufleuchten. Es hätte mich nicht gewundert, auch den Gesang einer Nachtigall zu hören. Selbst der sachlichste Mathematiker müßte hier zum Poeten werden …
Der Wind trug verwehte Glockenklänge und – das war kaum zu glauben – den weit weg, aber deutlich hörbaren Straßenlärm zu uns herauf. Die Ferienzeit hatte begonnen, und die Brandung des Reisestroms trug den fordernden Klang von Autohupen, das Quietschen von Bremsen, das Brummen von Motoren und hie und da das Heulen eines Polizei- oder Krankenautos bis in die Einöde des Monte Valdo. Armer Mathematiker, er müßte auch hier bei seinen Zahlen bleiben …
Aber wahrscheinlich saß er sowieso in einem der unten durchfahrenden Autos und begab sich ins Grandhotel von Locarno oder Ascona. Ich brach meine Spintisierereien ab.
„Gute Nacht, Michelangelo. Morgen graben wir die drei übrigen Wasserstränge aus.“
Die Notfallapotheke
Ein paar Stunden später erwachte ich schweißgebadet. In meinen Eingeweiden wühlten tausend Messer. Es war mir sterbensübel. Mühsam erhob ich mich, entzündete mit zitternden Händen eine Kerze und machte mich auf den Marsch zu unserem Klosett.
Bis jetzt war ich immer stolz darauf gewesen, das Gabinetto mit der schönsten Aussicht zu besitzen. Michelangelo hatte aus Kastanienstämmchen eine Art Laubhüttlein gebaut, etwa fünfzig Meter von den Häusern entfernt im Wald. Auf drei Seiten hatte er es mit Plastikwänden versehen. Gegen den Monte Ceneri war es offen. Eine Tür brauchten wir in dieser Einsamkeit nicht. Ein anderthalb Meter tiefes Loch, rechts und links ein paar Bretter darübergelegt und zwei kunstvolle Halter aus Draht, einer fürs Papier, der andere für den Kalksack, das war alles.
Solange man gesund ist, geht das wunderbar. Es geht auch, wenn einem schlecht ist. Man frage nur nicht, wie.
Auch diese längste aller Nächte ging einmal vorbei. Wie oft ich in den Wald und wieder zurückgepilgert bin, habe ich nicht gezählt. Susi begleitete mich jedes mal getreulich. Ich tröstete mich damit, daß es bei Regenwetter noch schlimmer gewesen wäre.
Ich rief nach Michelangelo, sobald ich seine Zoccoli klappern hörte, und bat ihn, mir die Apotheke zu bringen.
Im stillen lobte ich mich selbst. Wie klug war ich doch gewesen, eine bestausgerüstete Notapotheke anzuschaffen, mit Medikamenten für alle nur möglichen Krankheiten: Kopfweh, Fieber, Erkältungen, Durchfall, Verstopfung, Herzbeschwerden, Insektenstiche, Verstauchungen, Ohrenweh, Augenentzündung, Rheuma. Sogar Antibabypillen waren drin.
Es ist nie gut, sich selbst zu loben.
Michelangelo brachte mir die Schachtel mit der Bemerkung, er fürchte, sie sei nicht mehr ganz komplett. Ich öffnete sie. Da war kein Coramin mehr, kein Hustensirup, die Schachteln mit Mitteln gegen Verstopfung, Fieber, Durchfall waren leer. Auch die Dose mit den Antibabypillen.
Die Kohlepastillen waren noch da, Gott sei Dank.
„Die schwarzen Tabletten mochte ich nicht. Aber die andern habe ich vorsichtshalber ausprobiert. Ich finde, sie taten mir alle sehr gut.“ Also sprach mein starker Arm und Helfer.
Ich war viel zu schwach, um mit ihm zu schelten, und auch zu schwach, um zu lachen. Zum Glück hatten ihm die Kohletabletten nicht zugesagt.
Drei Tage lang lag ich mit Fieber im Bett, trank Schwarztee, aß Kohle und Äpfel, die Michelangelo sorgsam auf der Käseraffel für mich rieb. Er war ein rührender Pfleger, voller Besorgnis und mit vielen Ideen, was mir guttun könnte. Daß ich weder Grappa noch Wein trinken wollte, verstand er nicht.
„Grappa desinfiziert doch, und Wein stärkt. Das hat mein Babbo immer gesagt. Drum bin ich so stark.“
Offenbar stimmt es, daß Grappa desinfiziert. Die Ursache meiner Krankheit lag wahrscheinlich darin, daß ich aus lauter Freude an unserm Quellenfund den Salat aus Versehen mit Zisternenwasser gewaschen hatte. Michelangelo trank nach dem Essen immer sein Gläslein Grappa. Ihm hatte der Salat nicht geschadet.
Sobald ich wieder auf den – allerdings wackligen – Beinen stand, entschloß ich mich, auch Grappa zu trinken. Vorbeugen ist besser als eine leere Notfallapotheke.