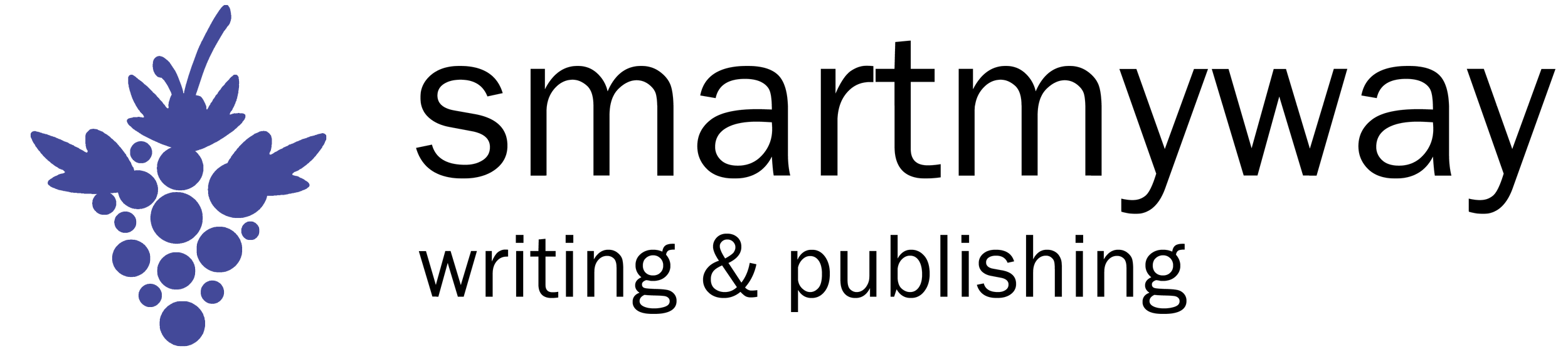Sie bezahlen, was Sie wollen.
Auf dieser Seite können Sie das Buch Kleine Welt im Tessin kostenlos lesen. In jener Schreibe, wie es die Autorin 1974 verfasst hatte. Wir veröffentlichen zum Start jede Woche ein neues Kapitel. Sie entscheiden, wie Sie die weitere Verlagsarbeit von smartmyway unterstützen möchten. Sie haben die Wahl:
Sie lesen das Buch kostenlos, freuen sich daran und empfehlen uns weiter.
Sie lesen das Buch kostenlos und tragen sich in unserer Leserliste ein, damit wir Sie über unsere Aktivitäten informieren können.
Sie lesen das Buch und spenden uns einen Betrag, den Sie für angemessen halten.
Sie lesen das Buch, indem sie es bei Amazon oder bei uns im Verlag für sich selbst oder zum Verschenken kaufen.
Mit herzlichen Tessiner Grüssen!
Roland Voser & Maurizio Vogrig
Verleger smartmyway
Cademario im Frühling 2025
Vielen Dank, dass Sie uns unterstützen!
Ich möchte freiwillig etwas bezahlen.
Wir freuen uns über jeden Betrag, mit dem Sie unsere Arbeit unterstützen möchten.
Hier ist der Einzahlungsschein für Ihre Spende für die Kleine Welt im Tessin.
Schreiben Sie uns bitte, damit wir uns bei Ihnen bedanken können. Herzlichen Dank!
Ich möchte das Buch in klassischer Form lesen.
Wir freuen uns über Ihren Kauf bei Amazon. Innerhalb der Schweiz liefern wir auch direkt vom Verlag.
Die Tessiner Tagebücher von Kathrin Rüegg.
In den letzten 5 Jahren hat der Schweizer Verlag smartmyway in vielen unentgeltlichen Stunden Kathrin Rüeggs Bücher neu aufgelegt, weil die lebensbejahenden Geschichten dieser bemerkenswerten Unternehmerin aktueller denn je sind und ein neues Publikum erreichen sollen.
Der Verlag präsentiert 2025 dieses ideelle Projekt erstmals komplett mit den neun Tessiner Tagebüchern in Taschenbuchform als Einzelbände und in drei Sammelbänden, sowie den zwei dazu gehörenden Bildbänden. Sogar eine englische Version gibt es jetzt vom ersten Band.
Kleine Welt im Tessin von Kathrin Rüegg.
Erstes Tessiner Tagebuch.
Ein Lesebuch von smartmyway.
Kapitel 6.
SEPTEMBER
Eine Bank kracht
Onkel Arthur verschob seine Abreise immer wieder. Wir konnten uns schon gar nicht mehr vorstellen, wie es ohne ihn sein würde. Viele kleine Arbeiten hatte er still übernommen.
Er wusch das Geschirr, wischte die von den schmutzigen Hundepfoten immer staubigen Fußböden auf, goß die Tomaten und stritt sich mit Michelangelo um die Ehre, die Tiere zu füttern.
Er war es auch, der ein System erdachte, mir mit vier Litern Regenwasser die Haare zu waschen. Man mußte nur ein Viertel der üblichen Shampoomenge verwenden, das ablaufende Wasser in einem Becken wieder auffangen und so mindestens zweimal verwenden. Es ging wunderbar.
„Hier ist es so grün, und London ist so grau“, sagte er einmal wehmütig. Aus vielen seiner Bemerkungen schloß ich, daß er äußerst bescheiden lebte. Er bediente ein paar seiner alten Kundinnen in ihren Häusern. Ganz geheim hoffte er, die Herzogin von Stoneville werde ihm eine Rente hinterlassen.
„Aber sie will einfach nicht sterben“, jammerte er.
„Jetzt ist sie schon sechsundachtzig Jahre alt. Seit einundfünfzig Jahren lasse ich mich zweimal wöchentlich von ihr schikanieren.“
„Komm doch ganz zu uns“, schlug ich ihm vor.
„Wegen meiner Frisur wirst du nie geplagt.“
Er wollte sich‘s überlegen, hatte aber einige Bedenken, wenn er daran dachte, auch den Winter hier verbringen zu müssen.
Auch meine Gedanken beschäftigten sich mit den kommenden Monaten. Michelangelo hatte zwar fleißig alles dürre Holz im Wald gesammelt und im Stall einen großen Holzstoß errichtet. Ich war dafür, einen Ofen zu kaufen. Michelangelo dagegen glaubte, der Kamin genüge. Er sei immer noch viel wärmer als die Telefonkabinen bei der Post in Locarno. Er vergaß, daß ich keine Erfahrungen im Übernachten in solchen Unterkünften hatte.
Der Ofen stand im Budget, genau wie der Generator, den ich nun bestellen wollte. Sobald mein Gipsfuß es zuließ, konnte ich mit den Installationsarbeiten beginnen.
Ich war daran, den Auftrag für Kabel, Stecker, Schalter und Sicherungen zu schreiben, als Michelangelo, von der Post zurückkommend, die Zeitungen brachte. In dicken Schlagzeilen stand darin, daß die Sparbuchbank AG den Konkurs angemeldet hatte.
Dort war fast mein ganzes Vermögen angelegt und das war jetzt futsch! Nun konnte ich den Generator in den Schornstein schreiben, das Schwimmbad dazu, auch den schönen Butangasherd mit Backofen und den Eisschrank. Die Prospekte dafür waren mit der gleichen Post angekommen. Onkel Arthur saß glückstrahlend mir gegenüber und wollte mir irgend etwas Freudiges mitteilen. Michelangelo hatte ihm einen Brief gebracht.
Als er mich ansah, hielt er inne: „O dear, was ist denn geschehen? Fühlst du dich schlecht?“
Michelangelo kam schon mit der Grappaflasche und einem Weinglas. Ein Cognac wäre mir lieber gewesen oder ein doppelter Whisky.
Ich stürzte Michelangelos Medizin hinunter. Dann übersetzte ich den Inhalt der Zeitungsnotiz erst ins Englische und dann ins Italienische, jeweils mit meinem Kommentar versehen.
„Damned, damned, damned“, sagte Onkel Arthur. Er war so erschüttert, daß er die Fliege nicht beachtete, die über seine Hand kroch. Er schenkte sich auch ein Glas Grappa ein.
„Cristo, Madonna“, sagte Michelangelo.
Er trank drei doppelte Schnäpse und schüttete den restlichen Inhalt der Flasche in mein Weinglas. Viel war es nicht mehr.
In Onkel Arthur mußten ungeahnte Reserven von Kampfesgeist stecken. Sogar sein Bart reckte sich kriegerisch nach vorn.
„Nur nicht verzweifeln, jetzt wird gekämpft“, tröstete er mich und streichelte mir die Hand. Michelangelo, der mir gegenüber saß, fuhr sacht über meine andere Hand.
Beinahe hätte ich trotz meines Elends gelacht. Was konnte mir schon passieren, wenn mir ein vermögensloser alter Onkel und der noch ärmere Michelangelo beistanden und mir sogar die Hände streichelten? Onkel Arthur nahm den silbernen Drehstift, der immer in seiner Hemdtasche steckte, und legte die Zeitung mit der Hiobsbotschaft so vor sich hin, daß er den Rand für Notizen brauchen konnte.
„Wieviel bleibt dir noch übrig?“
„Ich weiß nicht genau, etwa zehntausend Franken.“ Onkel Arthur malte sorgfältig eine Eins und vier Nullen aufs Papier. Darunter setzte er die Zahl zweitausend.
„Was soll denn das sein?“, fragte ich.
Er legte den Brief aus England vor mich hin. Ich las:
„Dear Sir,
Es freut uns, Ihnen mitzuteilen, daß wir Ihnen für die beiden Katzenfotos „Her Majesty the Cat“ und „Bimbo Darling“ den ersten Preis unseres diesjährigen Fotowettbewerbs zusprechen können. Einen Scheck über zweihundert Pfund legen wir hier bei.
Very truly yours, Katzenklub des Vereinigten Königreichs
Der Präsident: Lord Samuel Kimberley“
„Please excuse me“, sagte ich zu Onkel Arthur, und „Scusi“ zu Michelangelo. Dann erst legte ich den Kopf auf die Arme und heulte …
Längst hatte ich vergessen, daß mich Onkel Arthur bald nach seiner Ankunft um die Filme der beiden Fotos gebeten hatte. Ein Bild zeigte Susi Stäubli, wie sie in Froda am Fenster saß, den Blick kühl abwägend direkt dem Betrachter zugewandt. Den Titel „Ihre Majestät die Katze“ hatte Onkel Arthur erfunden. Wahrscheinlich war der schuld, daß meine Fotografie so gut bewertet wurde.
Ihre Majestät, das Susi Stäubli! Jetzt lachte ich mit tränenverschmiertem Gesicht.
„Bimbo Darling“ war ein süßes Bild, fast eine Reklame für irgendeine feine Schokolade. Es zeigte das Bimböli im Alter von sechs Wochen auf der Stalltreppe: ein rosarotes Näslein, zwei himmelblaue, erstaunt blickende Augen, eines der Vordertätzchen adrett nach außen gedreht. Die weit abstehenden Schnurrhaare und die langen weißen Haare, die den innern Ohrrändern entlang wuchsen und sich gegen den dunkeln Hintergrund abhoben, gaben dem Bild etwas so Plastisches, daß man glaubte, das Kätzchen streicheln zu müssen. Aber nie hätte ich daran gedacht, mit meinen Fotos einen Preis zu erringen. Auch daran war Onkel Arthur schuld.
Der große Kriegsrat tagt
Onkel Arthur klopfte mit seinem silbernen Bleistift ans leere Grappaglas.
„Silentium“, sagte er. Auch Michelangelo verstand, daß eine wichtige Sitzung im Gang war.
„Wir müssen uns jetzt anstrengen und nach weiteren Erwerbsquellen forschen.“
Er wandte sich zu mir:
„Wie lange, glaubst du, werden wir mit den zwölftausend Franken leben können?“
Ich holte mein Haushaltungsbuch. Meine Mutter hatte mir beigebracht, daß man sorgsamer wirtschaftet, wenn man die Ausgaben aufschreibt.
Für Nahrung brauchte ich in der Woche durchschnittlich hundert Franken. „Inklusive Tiere?“, fragte der Präsident der Sitzung streng.
„Jawohl.“
Er notierte diese Zahl auf dem gegenüberliegenden Zeitungsrand.
Michelangelo bekam pro Woche zehn Liter Barbera (ich hatte seine Ration erhöht, weil er so fleißig war). Das kostete vierundzwanzig Franken. Und eine Flasche Grappa, für die bezahlte ich sechzehn Franken. Die fünf Liter Vino da pasto für Onkel Arthur und mich stellten sich auf etwa acht Franken. Das gab total rund ein hundertfünfzig Franken pro Woche.
„Von jetzt an trinke ich eben auch ‚Ving da past‘“, sagte Michelangelo. Wenn ich bedachte, wie sehr er meinen Wein immer verspottete, konnte ich das Opfer nicht hoch genug einschätzen.
Wir notierten alles: Krankenkasse, Versicherungen, Portospesen, Steuern, Kleiderausgaben. Onkel Arthur erinnerte sich noch daran, daß die Katzen gegen Katzenseuche und die Hunde gegen Staupe geimpft werden mußten. Auch dieser Betrag wurde im Budget eingeplant.
„Und wieviel verdient Michelangelo?“
Ja, das war so eine Sache. Michelangelo wollte nämlich von Anfang an keinen Lohn. Ich wußte auch, daß Geld für ihn nicht das richtige war. Wir einigten uns so, daß ich monatlich einen Teil seiner Schulden abstotterte. Und Schulden hatte er! Es verging kaum eine Woche, daß er nicht einen eingeschriebenen Mahnbrief erhielt.
Wenn wir mit diversen Unbekannten rechneten, würden die zwölftausend Franken doch ausreichen, um ein Jahr lang zu leben. Es ging aber nicht nur darum. Wir mußten auch Geld beschaffen für die Instandstellung der Häuser. Wehmütig dachte ich an den Esel und die Gärtnerin. Mußte ich auch die unter meinem zusammengestürzten Kartenhaus begraben?
Michelangelo hob die Hand.
„Signor Presidente, ich hätte ein paar Vorschläge.“ Onkel Arthur nickte wohlwollend.
Bald würden die Kastanien reif sein. Einen Franken verlangten sie in Locarno für hundert Gramm gebratene Marroni.
Wenn wir uns daran machen würden, Kastanien zu sammeln, hätten wir in ein paar Tagen eine ganze Tonne beisammen. Michelangelo erbot sich, irgendwo im Tal als Marronimann zu amten. Wenn hundert Gramm einen Franken kosteten, dann ergäbe eine Tonne … Er verhedderte sich in vielen Nullen.
„Kastanienvorschlag wird zur Prüfung angenommen“, bestätigte Onkel Arthur.
Vorschlag Nummer zwei Michelangelos jagte mich vom Stuhl:
„Die Caterina sitzt so oft an der Schreibmaschine. Sie könnte doch pornographische Geschichten schreiben. Ich weiß, daß man mit Pornographie viel Geld verdienen kann.“
Onkel Arthur hatte nur „Caterina“ und „Pornographie“ verstanden. Er starrte mich sprachlos an.
Ich aber nagelte Michelangelo fest: „So, und wieso weißt du, daß man mit Pornographie reich werden kann?“ Endlich hatte er etwas verraten, das offenbar mit seinem früheren Leben zusammenhing.
Er konnte so schön erröten, der Fachmann für Pornographie!
„Eh, ja, das war so, weißt du“, stotterte er. Aus der etwas unzusammenhängenden Geschichte entnahm ich, daß es in der Nähe der Acquaverde-Mündung im See kleine Inselchen gab, die von Liebespärchen aufgesucht wurden. Ein paar große Schlaumeier und Geschäftemacher hatten in den alten Bäumen Filmapparate mit Teleobjektiven installiert. Michelangelos Aufgabe war es gewesen, die Jagdbeute in den Bars von Ascona zu verkaufen.
„Dick habe ich verdient dabei. Aber dann schnappten sie mich.“ Zwei Jahre Gefängnis hatte ihm das eingetragen. Seine Auftraggeber wurden nicht erwischt.
Das wurmte ihn mächtig. Ein Teil seiner Alkoholsucht ließ sich vielleicht dadurch erklären.
Zu meinem Leidwesen nahm Onkel Arthur auch den Pornographievorschlag zur Prüfung entgegen. Mit Vorbehalt allerdings.
Jetzt hob ich die Hand auf.
„Ich könnte während der Wintersaison in einem Wintersportort als Sekretärin arbeiten. Leute mit Sprachkenntnissen sind gesucht.“
„So, und wer hilft mir, die Bäume zu fällen, deren Holz wir für die Geländer, Zäune und Dächer brauchen? Dagegen erhebe ich Einspruch.“ Michelangelo wurde energisch.
„Dem Einspruch wird stattgegeben“, bestätigte Onkel Arthur. „Michelangelo hat recht.“
Nach einigem Nachdenken fügte er bei: „Und den Marronimann-Vorschlag lehnen wir ebenfalls ab. Wir müssen Arbeit finden, die sich neben unserm üblichen Tagesprogramm hier durchführen läßt. Sonst haben wir schließlich auf dem Monte Valdo noch eine Unterkunft; aber die Instandstellung der Häuser geht nicht weiter, die Wasserleitung wird überhaupt nie gegraben und schließlich schläft das Dörfchen wieder ein.“
Michelangelo tröstete er noch mit der Frage, ob er je schon einen reichen Marronimann gesehen habe.
Dann unterbreitete der Präsident des Kriegsrates selbst einen Vorschlag, den wir schließlich als ersten einstimmig und ohne Vorbehalt annahmen:
„Wie wäre es, wenn wir versuchen würden, die Confiture délicieuse de la grand-maman in einem Delikatessengeschäft zu verkaufen?“
La vera marmellata del Monte Valdo
Unsere Tomatenstauden hingen immer noch voller Früchte. Wir pflückten die grünen, und Onkel Arthur kochte ein paar Kilo Konfitüre.
Er stutzte Michelangelo die Haare und den Bart, dann warf sich der neu ernannte Vertreter der Monte-Valdo-Konfitürenfabrik SA in den Sonntagsstaat.
In Ermangelung genügender Gläser hatten wir unsere Tazzini gefüllt. Offenbar war es diese Verpackungsart, die den Besitzer des großen Delikatessengeschäftes in Locarno zu einer Bestellung bewog. Es waren in verschiedenen großen Schweizer Städten Werbewochen für Tessiner Spezialitäten geplant. Eine echte Tessiner Konfitüre, verpackt in ein echtes Tessiner Trinkgefäß, das hatte noch gefehlt. Die erste Bestellung lautete auf 2000 (zweitausend!!) Tazzini, gefüllt mit „La vera marmellata del Monte Valdo“. Stückpreis für Wiederverkäufer zwei Franken zwanzig.
Niemand brauchte zu erfahren, daß das Rezept von einer Großmama aus Coppet stammte und der Koch beinahe ein Engländer war.
Die Tomaten jedenfalls waren echt. Wir erhielten sie meist gratis von den Bauern aus Sassariente und Umgebung. Die waren froh, ihre Felder räumen zu können. Kopfschüttelnd fragten sie, was wir damit denn tun wollten.
„Schweine mästen“, sagte Michelangelo. Er wurde nicht einmal rot dabei.
Mit den Tazzini war es schwieriger. Ich fand wohl den Grossisten, der sie an alle die kleinen Dorfgeschäftchen verkaufte. Er hatte aber nur noch dreihundert Stück an Lager. Lieferfrist für die restlichen tausendsiebenhundert acht Wochen! Bis dann waren unsere Tomaten verdorben.
Es ist unsere Schuld, daß in diesem Herbst weder im Acquaverde-Tal noch im Gambarogno, noch in Locarno oder Bellinzona Tazzini erhältlich waren! Wir grasten alle großen und kleinen Geschäfte ab und kauften jeweils den ganzen Bestand. Michelangelo war eine unschätzbare Hilfe, weil er mit südländischem Talent und Temperament feilschte. Ich habe das in meinem Leben noch nie gekonnt.
Zweihundertfünfzig Kilo Tomaten, zweihundertfünfzig Kilo Zucker und die zweitausend Tazzini schleppten wir auf unsern Berg, dazu die übrigen Zutaten, die ich nicht verraten darf, weil Onkel Arthur sein Rezept heilighält.
Wir schafften uns zwei große Pfannen an und eine Reservebombe Butangas. Maria aus Froda lieh mir ihre Fünf-Kilo-Küchenwaage. Eine schöne Etikette, die Michelangelo gezeichnet hatte, war im Druck.
Der Stall wurde zur Konfitürenfabrik. Wir bedeckten die Wände mit Plastik, legten ein ebenfalls mit Plastik bezogenes Brett auf die Futterkrippe, trugen vorerst sechzig Liter Trinkwasser her und wuschen unsere Tazzini. Onkel Arthur ernannte sich selbst zum Lebensmittelinspektor und kontrollierte jedes einzelne Gefäß beinah mit der Lupe, ob es sauber gewaschen und sauber abgetrocknet sei.
Dann kam seine Arbeit, bei der wir ihm nicht helfen durften. Sie sei zu delikat, sagte er. Er wog zweimal fünf Kilo unserer Früchte und zweimal fünf Kilo Zucker ab und begann mit seiner Kocherei.
Neun Tage lang qualmte der Dampf aus der Stalltür. Der Geruch war entsetzlich. Michelangelo und mir wurde übel. Einzig Onkel Arthur hielt mit blendend weißer Schürze und seinem Kochlöffel ohne ein einziges Wort der Klage durch.
Jeden dritten Tag lieferten wir unsere Produktion ab. Dann kam die Abrechnung. Wenn wir alle unsere Spesen in Betracht zogen, aber keinen Arbeitslohn rechneten, hatten wir zweitausendvierhundertdreiundfünfzig Franken rein netto verdient.
„Siehst du“, sagte Onkel Arthur stolz, „wofür so ein alter Onkel gut sein kann.“ Der berühmte Silberstreifen am Horizont hatte bei mir die Form eines Esels …
Ich gab Onkel Arthur einen Kuß auf die Nase.
„Aber ich“, sagte Michelangelo, „ich esse in meinem ganzen Leben nie mehr einen Löffelvoll Tomatenkonfitüre.“ So undankbar war er.
OKTOBER
Die vergessenen Désirées
Ende September hatten wir unsere Kartoffeln ernten wollen. Die Bankkatastrophe und die Marmellata hatten unser Programm jedoch gründlich auf den Kopf gestellt. Das Laub der Désirées war seit gut zwei Wochen abgefault. Gemäß meinem Gartenbuch war es also höchste Zeit, mit der Ernte zu beginnen. Wir hatten unsere Ungeduld gezügelt und nie eine Staude ausgezupft. Ob unsere Ernte ergiebig sein würde?
„Fang du an“, sagte Michelangelo.
Sechzehn Kartoffeln hingen an der ersten Pflanze. Sie waren wie kleine rosa Schweinchen, mit wunderschön glatter Haut.
„Darf ich auch helfen?“, fragte Onkel Arthur bescheiden. Er mochte ja sonst keine Arbeiten, bei denen man die Hände beschmutzt. Aber unsere Kartoffeln zu ernten, war keine Arbeit. Es war wie Goldgräberei, wenn man weiß, daß Gold da ist. Jeder wollte den andern mit seinen Pflanzen überbieten.
„Che bella Désirée“, rief Michelangelo und hob mir eine besonders schöne Knolle entgegen.
„Nineteen potatoes“, schrie Onkel Arthur, „oh, no, that‘s impossible, look at that!“
Sogar die Hunde wurden von unserem Eifer angesteckt. Sie gruben mit den Vorderpfoten in dem von uns schon abgeernteten Teil des Äckerleins und suchten nach den zurückgebliebenen Kartoffeln. Sie fanden noch etliche.
Wir wischten die gröbste Erde ab und sortierten sie gleich nach der Größe. Die kleineren waren für „patati in camisa“, wie man im Tessin die Schalenkartoffeln nennt. Onkel Arthur brachte Marias Waage. Aus fünf Kilo Saat waren in der Erde, der Sonne und dem Regen des Monte Valdo zweiundneunzig Kilo geworden!
„Rechne mit einem zehnfachen Ertrag“, hatte Heini geschrieben. Wenn er nun das hörte!
„Jetzt ist es ganz gewiß, daß wir die dümmsten Bauern weit und breit sind“, sagte Michelangelo.
Daß er doch immer das letzte Wort haben mußte!
Und nach der Konfitüre die Pornographie
Es regnete. Unser Platz hatte sich in eine Schlammgrube verwandelt. Das Wasser schwemmte die schönen, bunten Herbstblätter weg. Wir waren alle ein wenig melancholisch. Onkel Arthur mit seiner „Times“ und die Tiere saßen am flackernden Feuer. Michelangelo malte, ich strickte. Ein friedliches Bild.
„So, Caterina, jetzt kommst du dran.“ Michelangelo startete offenbar einen Angriff.
„Mit was, wenn ich bitten darf?“
„Denk an die Pornographiegeschichte, die du zu schreiben versprochen hast.“
„Oeh!“
Dieser Tessiner Ausruf ist ungemein vielseitig. Je nachdem, ob man ihn ausklingen läßt oder abrupt abbricht, lang auszieht und dann hinten noch ein E anhängt, ersetzt er ein ganzes Vokabular des Erstaunens, des Entsetzens, der Empörung oder des Entzückens.
Mein „Oeh“ bedeutete eindeutiges Entsetzen.
Michelangelo konnte furchtbar hartnäckig sein. Er plagte mich so lange, bis ich meine Schreibmaschine hervorkramte und darauf herumklapperte, nur damit er mich in Ruhe ließ.
Irgendein inneres Stimmchen stupste mich. „Versuch‘s doch mal“, sagte das leidige Ding.
„Aber ich habe doch kein Talent dazu“, antwortete ich ihm.
„Das kannst du nicht wissen, denn du hast es noch nie probiert“, entgegnete das Stimmchen. Es war offenbar so hartnäckig wie Michelangelo.
Ich erinnerte mich an eine gestörte Nacht in Froda und schrieb darüber folgende Geschichte:
Die Nacht selbdritt
Genau weiß ich nicht mehr, weshalb ich auf diese ausgefallene Idee kam. Daß alles so schiefging, ist sicher zum Teil auch Hudels Schuld.
Angefangen hat es damit, daß ich mich entschloß, mit Susi zu schlafen, weil ich mich einsam fühlte und nach ein wenig Wärme sehnte. Mit seiner unglaublichen Intuition erriet Hudel aber mein Vorhaben.
„Nimm mich auch mit“, bettelten seine braunen Augen.
„Was meinst du dazu?“, fragte ich Susi.
Aber sie war gerade damit beschäftigt, ihr hübsches Frätzchen im Spiegel zu betrachten, und gab keine Antwort. Offenbar war es ihr egal, ob wir die Nacht zu zweit oder zu dritt verbrachten. Man kommt nie ganz dahinter, was dieses Weibsbild denkt.
Ich machte ausgiebig Toilette. Schließlich gehört sich das.
Als Susi und ich ins Schlafzimmer kamen, lag Hudel schon im Bett. Er hatte sich quer so über die ganze Breite drapiert, daß wohl die schlanke Susi noch neben ihm Platz hatte, ich aber offenbar meine Schlafstatt irgendwo anders suchen sollte. Das paßte mir gar nicht. Schließlich war es meine Idee gewesen, mit Susi zu schlafen. Ich schubste ihn.
„He, geh ein bißchen auf die Seite.“
Er schaute mich an, gähnte ungeniert und rollte sich auf den Rücken. Ich packte ihn an den Beinen und drehte ihn so, daß er längs im Bett lag. So hatten auch Susi und ich noch Platz. Susi schlüpfte zu mir unter die Decke und hatte ein diebisches Vergnügen daran, ihre kleinen kalten Füße an meinem Bauch zu wärmen.
Sanft streichelte ich ihren Rücken. Sie gab eine Reihe von Tönen von sich, die wohl höchstes Entzücken ausdrücken sollten. Dann schliefen wir alle drei ein.
Bald erwachte ich wieder. Hudels Schnarchen hatte mich aufgeschreckt. Er sägte, keuchte und röchelte.
„Nun ja, er ist schließlich auch nicht mehr der Jüngste“, entschuldigte ich mich bei der inzwischen auch aufgewachten Susi. „Lassen wir ihn eben schnarchen und vergnügen wir uns ein bißchen.“
Susi hat so ihre eigenen Ansichten, wie man sich vergnügen kann. Sie schlüpfte unter der Decke hervor und hopste wild auf dem Bett herum. Zwischendurch machte sie Anstalten, die Bettdecke zu zerfetzen, und zerbiß in plötzlich auflodernder Leidenschaft eine Franse des Überwurfs. Hudel öffnete schlaftrunken ein Auge, drehte sich um und döste weiter.
Er schnarchte nicht mehr, aber er wimmerte und zuckte mit den Beinen. Susi hatte unterdessen mit ihrem Gezappel das Telefon heruntergeschmissen. Sie saß vor dem am Boden liegenden Hörer und lauschte mit schräggestelltem Kopf dem klagenden Ton, der daraus hervordrang.
Ich wollte einen Schluck Orangensaft aus der Flasche trinken, die immer auf dem Nachttisch steht. Aber Susi hatte die Flasche umgeworfen. Der letzte Rest des Inhalts ergoß sich eben glucksend auf den Teppich.
Da wurde es mir zu bunt. Ich verließ meine unruhigen Schlafkumpane und legte mich im Gästebett zur Ruhe. Die beiden mochten machen, was sie wollten. Als ich am Morgen meine Schlafzimmertür öffnete, begrüßte mich Hudel mit fröhlichem Gebell, und Susi strich zärtlich miauend um meine Beine …“
Es war unbequem, einen italienisch und einen englisch sprechenden Kritiker zu haben, mußte ich doch meine Geschichte gleich zweimal übersetzen. Michelangelo kam zuerst dran.
Nach der ersten Hälfte rühmte er mich.
„Brava, brava.“ Die kalten Füße und der warme Bauch waren vielversprechend. Auch daß ich „sie“ Susi getauft hatte, fand er richtig. Susi hatte schließlich schon beim Fotowettbewerb Glück gebracht. Der Name Hudel paßte ihm nicht. Schon darum nicht, weil er ihn nicht aussprechen konnte.
„Udl“, sagte er, „Udl ist zuwenig sexy.“ Michelangelo hatte den Hudelhund eben nicht gekannt. Darum war er auch vom Ende meiner Geschichte bitter enttäuscht.
„Ah ba“, sagte er, „das ist ein Tiergeschichtlein für Kinder im Pinocchio-Alter. Und dabei war der Anfang so spannend.“
Sein Urteil war so niederschmetternd, daß ich Onkel Arthur mit meinem Werk verschonen wollte.
Aber auch er konnte hartnäckig sein. Schließlich las ich ihm meine englische Version stockend vor.
„Not so bad“, lautete sein Urteil. „Nur – unbedingt pornographisch möchte ich es auch nicht nennen. Aber“ – und er hob seinen spitzen Zeigefinger – „man kann auch andere Geschichten verkaufen, nicht bloß pornographische.“
„Glaubst du wirklich, das Zeug taugt was?“ Ich war wieder einmal skeptisch.
Er redete mir so lange zu, bis ich die Geschichte nach etwa acht verschiedenen Um-, Rein- und noch reineren Abschriften an eine Illustrierte der deutschen Schweiz sandte. Eingeschrieben und mit Rückporto versehen. Onkel Arthur hatte das so gewollt.
Wir säten nicht und ernteten doch
Schon lange freuten wir uns auf die Weinlese. Obwohl während so vieler Jahre kein Mensch sie gepflegt und gegossen hatte, wuchsen in der Nähe der Häuser ein paar Rebstöcke.
Derjenige, der am Eichenbaum vor meinem Zimmerfenster emporkletterte, trug viele Früchte. „Americana“ nennt man diese Sorte. Beim langen Haus hatte eine andere Pflanze ihre Ranken übers ganze Dach gebreitet und hing ebenfalls voller kleiner blauer Trauben. Das waren „Clinton“. Diese Kenntnisse verdankten wir natürlich Ugo. Umsonst nannten wir ihn nicht den „Weisen“.
Er war es auch, der uns erklärte, wie man Wein macht. Wie man Trauben an Reben erntet, die sich an den äußersten Spitzen eines zehn Meter hohen Baumes emporwinden oder über ein Dach klettern, das man nicht betreten soll, konnte er uns allerdings nicht sagen. Alles, was wir pflückten, waren ein paar Körbe voll.
Die restlichen herunterzuholen, wäre lebensgefährlich gewesen.
„Lumpige zwanzig Kilo, das muß anders werden“, wetterte Michelangelo. Nächstes Jahr wollte ich zu Ugo in die Lehre gehen, um den Weinbau zu studieren. Bis ich alles wußte, was für den Betrieb des Monte Valdo nötig war, war ich hundert Jahre alt!
„Wie man Grappa brennt, brauchst du dann nicht zu lernen. Das kann ich schon.“ Wenigstens etwas, das mir Michelangelo abnahm.
Kastanien suchen war ein reines Vergnügen, fast so schön wie Kartoffeln graben. In kürzester Zeit war unser Militärtornister jeweils voll. Wir breiteten die Früchte im Stall zum Trocknen aus.
Michelangelo übernahm für viele Wochen die Zubereitung des Abendessens, das aus nichts anderem als gerösteten Kastanien und Glühwein bestand. Herrlich duftete es bei uns, wenn wir die frisch gerösteten Marroni aufbrachen. Wir durften die Pfanne ja nicht am Boden beim Kamin stehen lassen, denn die Tiere hatten diese Speise so gern wie wir.
Glühwein braute Michelangelo, weil Kastanien Durst geben und man so den Wein strecken konnte. Er versuchte immer neue Gewürzkombinationen. Als er eines Abends unser Getränk mit Kümmelzusatz servierte, streikten Onkel Arthur und ich. Michelangelo war sehr erbost darüber.
Die schönsten Kastanien legten wir auf die Seite. Onkel Arthurs Idee war es, den Erfolg der Marmellata del Monte Valdo mit Marrons glacés del Monte Valdo fortzusetzen.
Aber – das war der große Haken – wir fanden das Rezept nirgends.
Schließlich kam Onkel Arthurs unwiderruflich letzter Ferientag. Die Gültigkeitsdauer seines Flugbilletts lief ab.
„Never in my life I was so happy“, gestand er mir.
„Wenn ich an unsere Konfitüre denke!“ Er wollte nächstes Jahr so bald als möglich wiederkommen. Und seinen Malkasten mitbringen, und alles, was er zur Schmetterlingszucht brauchte. Ja, und ein Rezept für Marrons glacés würde er mir baldmöglichst schicken. Wo er das in England auftreiben sollte, war mir schleierhaft.
Zart und zerbrechlich stand er mit seinem Köfferchen am Bahnhof von Bellinzona, den weißen Bart sorgfältig geschnitten. Niemand hätte geahnt, wie kampflustig und zäh Onkel Arthur sein konnte.
„Leb wohl, lieber Onkel Arthur. Ich danke dir.“
Ich mußte mich sehr zusammenreißen, heiß stieg es in meine Augen.
„Gutt bay, addio zio Arthur“, sagte Michelangelo. Er merkte es gar nicht, daß ihm Tränen übers Gesicht kollerten.
„Seid tapfer“, sagte Onkel Arthur. „Ich bin ganz sicher, wenn ich wiederkomme, trägt ein Esel mein Gepäck auf den Monte Valdo.“
Der Zug war schon angefahren, als er mir noch zurief: „Und schreib mir, was aus der pornographischen Geschichte geworden ist!“
Hoffentlich verstanden die herumstehenden Leute nicht Englisch. Ich hätte mich sonst entsetzlich schämen müssen.
Auf der Post in Sassariente lag mein Manuskript.
„Tut uns leid“, schrieb das schweizerische Unterhaltungsblatt, „solche Erzählungen sind für unser Publikum zu gewagt.“
„Hörst du das, Michelangelo? Und du sagtest, es sei ein Pinocchio-Geschichtlein. Nie mehr schreibe ich solches Zeug!“
Aber Michelangelo war dagegen, aufzugeben.
„Dann probieren wir es eben mit der Zeitschrift, in der immer so schöne nackte Frauen abgebildet sind.“ Er wies auf eine zerlesene deutsche Illustrierte, in der er stundenlang blättern konnte.
Ich revidierte also meinen Text und schnitt ihn für den Sprachgebrauch in Deutschland zu.
Anstatt „Intuition“ hieß es jetzt „Einfühlungsvermögen“, anstatt „Toilette machen“ „wusch mich gründlich“, und anstatt „Orangensaft“ nein, nicht „Apfelsinensaft“, sondern „Whisky“. Das war verruchter.
Und es brachte mir einen schönen Scheck über dreihundert Deutsche Mark ein.
Ganz zaghaft begann auch ich daran zu glauben, daß nächstes Jahr Onkel Arthurs Gepäck auf einem Eselrücken transportiert werde.
Aber wenn wir wirklich einen Esel hatten, dann mußte er zu Onkel Arthurs Empfang auf den Bahnhof von Bellinzona mitkommen. Das schwor ich mir.